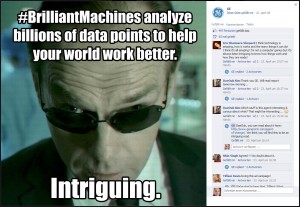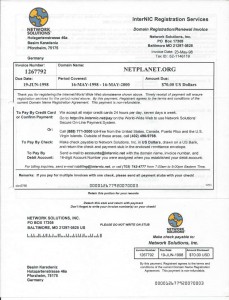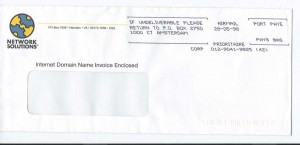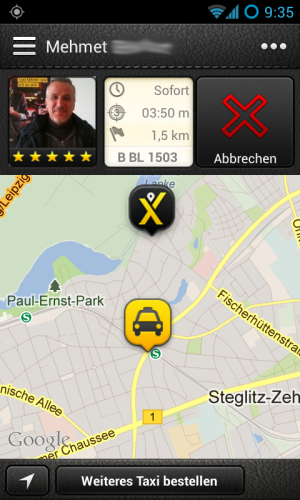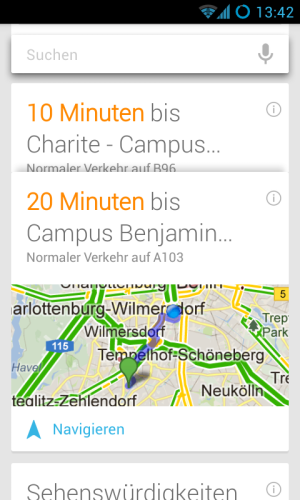Dass der Deutschen Telekom das Thema Flatrates schon immer ein Dorn im Auge war, ist nun wahrlich nichts neues. Schon 1998 gab es eine bemerkenswerte Aktion, die am 1. November 1998 in einem „Internetstreik“ mündete und die Forderung hatte, dass die Deutsche Telekom für Internet-Anschlüsse auf Basis von ISDN (DSL steckte damals noch im Beta-Stadium) Flatrate-Angebote starten solle und diese nicht einfach auch nach Zeittakt abrechnet, wie es damals bei normalen Telefongesprächen üblich war. Von Seiten der Deutschen Telekom kamen auch da eine ganze Lawine von Argumenten, warum Flatrates das Telefonnetz schädigen würden und was auch immer und nichts davon war auch nur ansatzweise wahr.
Denn tatsächlich geht es bei der Deutschen Telekom nur um das Geschäft und sonst nichts. Und selbst das läuft nur bescheiden gut, denn die Unternehmensgeschichte der Deutschen Telekom ist voll mit Geschichten von Unternehmenslenkern, die von einem Weltkonzern träumten, ähnlich wie so Konzerne wie z.B. AOL Time Warner, von dem inzwischen nur noch Bruchteile des damaligen Wertes übriggeblieben sind.
Größenwahnsinnige Unternehmer, grotesk aufgeblasene Aktienkurse, machtgierige Politiker, unfähige Unternehmenslenker, defekte Businesspläne. Bezahlt mit gewaltigen Milliardenverlusten, die durch ein ehemals steuerfinanziertes und mehrfach vergoldetes Telefonnetz und einem Heer von kündigungsunwilligen Kunden getragen werden, die sich immer noch von einem durch und durch staatstragend organisierten Dienstleister schikanieren, ausbremsen und ausnehmen lassen. Der Begriff „Terrorkom“, der damals im Rahmen der Aktivitäten rund um den Internetstreik in der Netz-Community entstand, ist da gerade richtig.
Nein, an der Deutschen Telekom lasse ich kaum noch ein gutes Haar. Man hat in dem Unternehmen schon immer verstanden, sich das feinste Netz fremdfinanzieren zu lassen, gleichzeitig aber an entscheidenen Stellen darüber zu jammern, wie schlimm doch die bösen Anbieter im Internet das „gerade noch funktionierende“ Netz der Telekom missbrauchen und nichts dafür bezahlen. Nichts von dem Gejammer der Telekom-Lobbyisten war und ist wahr. Und das wirklich skandalöse daran ist, dass es schon seit mindestens 15 Jahren bekannt und nachvollziehbar ist.
Vor über drei Jahren habe ich einen Kommentar zu einem Artikel zur Netzneutralität im Netzpolitik-Blog geschrieben, wo ich mir mal die Mühen machte, auf die warme Luft eines Telekomsprechers zu antworten, der mit den üblichen Argumenten gegen die Netzneutralität wetterte. Ich wollte den Kommentar schon immer mal hier weiter ausführen und leider ist der Kommentar immer noch Eins zu Eins so aktuell, wie damals und wie auch schon vor 15 Jahren. Ich habe da noch ein paar Dinge ergänzt:
1. „Die Telekom verdient beim Kunden in Sachen Internet kein Geld.“
Dieses Argument stimmt höchstwahrscheinlich nicht, ist aber kaum prüfbar. Fakt ist, dass Datenverkehr im Internet kaum noch etwas kostet. Kostete ein Gigabyte Datenverkehr vor einigen Jahren noch messbare Beträge, so ist der Preis für ein Gigabyte inzwischen auf unter 2 Cent gefallen. Datenverkehr kostet im Internet quasi nichts mehr, weil es einfach viel davon gibt und die zentralen Netze und deren Hardware leistungsfähig genug ist, das alles wirtschaftlich handzuhaben. Dazu kommt ein inzwischen genügend existierender Wettbewerb, der hohe Großhandelspreise von Hause aus verhindert.
Fakt ist, dass Internet-Anbindungen schon immer ein Mischgeschäft für einen Provider sind. Alle bekommen weitgehend einheitliche Preise, der eine surft mehr, der andere weniger. Mein Nachbar bekommt kaum mehr als 2 Gigabyte im Monat über seinen DSL-Anschluss zustande, während ich 100 Gigabyte locker erreiche und alle zahlen wir den gleichen Preis. Die 100 Gigabyte kosten die Telekom letztendlich aber auch kaum mehr als zwei Euro.
2. „Die Telekom verdient bei den Anbietern kein Geld.“
Und das ist sogar richtig, zumindest bei sehr vielen Angeboten von Dienstleistern, die keine direkte Anbindung zur Deutschen Telekom haben. Allerdings ist die Sichtweise genau der Kernpunkt bei der Frage der Netzneutralität. Wer ist eigentlich der „Verschmutzer“ im Internet? Der Anbieter oder tatsächlich doch eher der Konsument, der das Angebot des Anbieters in Anspruch nimmt? Wohl doch eher letzteres! YouTube erzeugt ja nicht von allein gewaltigen Datenverkehr, sondern es sind die Konsumenten, die YouTube-Videos anschauen und sich zum eigenen Rechner schicken lassen. Also müssen die dafür zahlen und, huch, das tun sie ja auch schon, nämlich mit ihrem Internet-Anschluss.
Die Telekom (und andere Anbieter) hätten aber eben durch die Aufweichung der Netzneutralität es aber auch gern, dass sie auch noch eine Rechnung an Google dafür schicken könnten. Und genau das ist falsch und gar nicht berechtigt.
Rein technisch gesehen ist Internet für Carrier (das ist die Deutsche Telekom vor allem) ein Einkaufsgeschäft, d.h. man nimmt vorne beim Kunden das Geld ein und schaut zu, sich das Internet von anderen Carriern möglichst günstig einzukaufen bzw. mit denen günstig zu peeren. Das macht die Telekom in der Enterprise-Klasse, die Deutsche Telekom gehört weltweit zu den Global Playern.
Aber, zugegeben … damit ist eben nur auf einer Seite Geld zu verdienen und das macht genügend Leute, die möglichst einfache Geschäftsmodelle für ihre Netze suchen, richtiggehend krank.
3. „Google zum Beispiel missbraucht aber so Anbieter die die Telekom und überschwemmt sie mit Traffic.“
Richtig: Google sorgt für viel Datenverkehr, den Kunden mit der Nutzung seiner Dienste auslösen. Und dieser Datenverkehr kommt bei Telekomkunden tatsächlich auch in das Netz der Deutschen Telekom und ist fremd. Falsch: Google missbraucht die Deutsche Telekom.
Auf Google schimpfen, ist herzlich einfach, dabei ist Google jemand, der schon lange erkannt hat, dass man als Inhaltslieferant den qualitativen Traffic zu den Kunden bringen muss. Darum betreibt Google weltweit einer der größten eigenen Business-Netzwerke und peert mit vielen Carriern quasi direkt vor Ort. Auch mit der Deutschen Telekom. Google legt also quasi den Datenverkehr, den seine Nutzer auslösen, der Deutschen Telekom direkt vor die Türe. Und an diesem „Private Peering“ verdient vor allem der Netzinhaber, der das vor die Türe gestellt bekommt, also auch die Deutsche Telekom.
Die Deutsche Telekom hat dieses Private Peering schon immer als Maxime angesehen und hält sich, zumindest im deutschen Raum, von zentralen Peering Points, an denen Provider ihren Datenverkehr untereinander weitgehend neutral austauschen, zurück. Bei ihr gilt das Motto: Wenn ihr in unser Netz wollt, müsst ihr eine eigene, dedizierte Leitung zu uns bauen und die müsst ihr natürlich auch schön bei uns anmieten.
4. „Die vielen Filme verstopfen das Netz der Deutschen Telekom und machen es unbrauchbar für die restlichen Kunden.“
Dass viele Entertainment-Angebote viel Datenverkehr auslösen, ist richtig. Dass solche Angebote kommen, war absehbar und das hat die Deutsche Telekom auch schon in ihrem allerersten Prospekt zur Einführung der T-Aktie ja auch so vorhergesehen. Das Problem dabei: Eigentlich wollte die Telekom das große Geld damit verdienen, hat dabei aber lange Jahre übersehen, dass sie für diese Art von Geschäftsmodell keine vernünftigen Angebote präsentieren konnte und dass die Hersteller von Medien das alles eben auch selbst oder mit anderen Dienstleistern machen konnten, die das Geschäft eher zustande brachten.
Sprich: Es gibt eben jetzt auch Telekom-Kunden, die sich Filme nicht mit den Entertain-Angeboten der Deutschen Telekom anschauen, sondern zum Beispiel über Maxdome oder Lovefilm. Und das nervt die Telekom ganz gewaltig und darum macht sie in ihrer offensichtlichen Verzweiflung einen großen Fehler: Sie will nämlich eigentlich Flatrates abschaffen, aber eben nicht für ihre eigenen Entertain-Angebote. Und das ist ein klarer Fall von Verletzung der Netzneutralität und gleichzeitig die Bestätigung, dass es bei der Abschaffung der Flatrate keineswegs darum geht, die ach so geschundenen Netze zu schützen, sondern vor allem die eigenen Angebote für zusätzliche Dienste.
5. „Die anderen Anbieter sind nicht besser, sie missbrauchen ja auch die Telekom auf der Letzten Meile.“
Ein früher häufig angewendetes Argument, dass in der Zwischenzeit von der Telekom jedoch nicht mehr so sonderlich gern verwendet wird, weil an dem Thema aufgrund des Wettbewerbzwanges nicht mehr zu rütteln ist. Und darüber hinaus auch gut und vor allem konkurrenzlos verdient wird.
Denn tatsächlich ist die Letzte Meile ein richtig gutes Geschäft für die Telekom. Und das selbst dann, wenn man die letzte Meile an die Konkurrenz vermieten muss. Denn die zahlt dafür einen monatlichen Fixbetrag und dafür muss die Deutsche Telekom dann machen: Fast nix. Was über die Leitung passiert, ist im Verantwortungsbereich des Wettbewerbers und wenn die Leitung mal kaputt ist, muss der Wettbewerber die Servicedienstleistung in der Regel bei der Deutschen Telekom einkaufen. Der Service ist vergleichsweise langsam und das überaus praktische dabei ist, dass der Kunde dann in der Regel auf seinen Anbieter schimpft, obwohl mitunter das Problem im Netz der Deutschen Telekom liegt.
6. „Ja, aber den Netzausbau muss die Deutsche Telekom stemmen, die Wettbewerber nutzen sie da nur aus.“
Das hört sich zwar plausibel an, denn tatsächlich muss nach der Privatisierung der Deutschen Telekom das Telefonnetz vor allem privatwirtschaftlich unterhalten und ausgebaut werden und nicht mehr aus Steuergeldern. Zumindest theoretisch. Die Praxis ist eine ganz andere.
Denn praktisch gesehen lässt sich die Deutsche Telekom den Ausbau ihres Telefonnetzes auf dem Land immer wieder doch ganz gern von Menschen bezahlen, die sich zu Interessensgemeinschaften organisieren lassen und gemeinsam einen Netzausbau dadurch finanzieren, dass sie längerfristige Verträge mit der Deutschen Telekom eingehen. Fast okay, aber wenn diese Bildung von Interessensgemeinschaften dann auch noch mit politischen Aktivitäten einhergehen, Aufrufen von Bürgermeistern und Absprachen über Leerrohre und Flächen für Verteiler, die Kommunen kostenlos oder vergünstigt zur Verfügung stellen sollen, dann sind das plötzlich keine Gefälligkeiten mehr, sondern Subventionen. Geredet wird darüber mitunter dann nicht mehr sonderlich viel, denn letztendlich müssen auch Kommunalpolitiker die nächste Wahl wieder gewinnen und das Mitwirken an vernünftigen Internet-Anschlüssen ist immer ein Gewinnerthema. Nur eben unterm Strich nicht immer für den Steuerzahler.
Und das führt dann zu so absurden Entwicklungen, dass bei Internet-Projekten auf dem weiten Land regelmäßig die Telekom Wettbewerber ausbremst. Die letzte Meile und die Zuführungswege gehören sowieso der Telekom und in Sachen Ausbau bringt die Telekom in der Regel immer mehr Erfahrung mit, als jeder große oder kleine Wettbewerber. Der Rest ist dann letztendlich nur Verhandlungsgeschick und im Notfall gut gesteuertes Hinhalten, denn, wie gesagt, spätestens die nächste Kommunalwahl entscheidet, ob das Thema Internet im Dorf ein Gewinner- oder ein Verliererthema für Amtsträger ist.