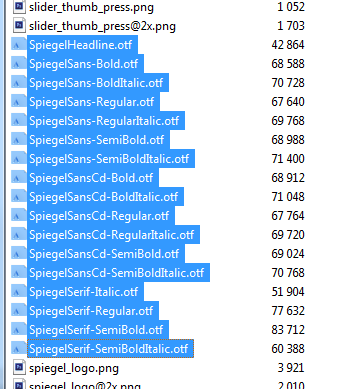Die bloggenden und geschätzten Herren Jens Stratmann, Thomas Majchrzak, Don Dahlmann und Robert Basic schreiben in ihren Weblogs darüber, ob die Premium-Autohersteller für die Zukunft gewappnet seien oder nicht. Die vier mit den obigen Namen verlinkten Artikeln empfehlen sich sehr für den geneigten Leser, wenn dieser sich für Autos interessiert, denn es geht weniger um Marketingaufwasch, sondern um Dimensionen, Denkweisen und Dogmen. Da ich mich von Berufswegen viel mit Opel beschäftige, will ich an dieser Stelle mit einem Beitrag zu Opel beitragen, auch wenn Opel von den meisten Fachleuten nicht als Premium-Marke angesehen wird. Wenn ich da sage „Kommt noch“, ist das ernstgemeint.
(Bei mir gibt es den Disclaimer gleich vorab: Ich betreue ein Opel-Autohaus in Pforzheim in Sachen Werbung, Marketing und Corporate Weblog, schreibe aber hier meine eigene, von meinem Kunden und von Opel unabhängige Einschätzung.)
„Du fährst Opel? Echt jetzt?“
Das Zitat ist nicht von mir, sondern von Karoline Herfurth, einer der Werbebotschafter der #umparkenimkopf-Kampagne von Opel. Herfurth fährt dabei einen Opel Ampera und erzählt dabei, wie es so ist, wenn man Opel-Fahrer ist und das dann im Freundeskreis erzählt. Und auch wenn das natürlich erst einmal eine Aussage in einem Werbespot ist – da steht viel Wahrheit drin, was nicht zuletzt durch die Familienbeziehung von Opel mit General Motors begründet ist. Ein kleiner, aber zum Verständnis wichtiger Exkurs:
Die diffizile Familienbeziehung zwischen Opel und der Mutter General Motors.
Opel ist seit 1929 ein Tochterunternehmen von General Motors, einem US-amerikanischen Autohersteller in Detroit. Opel ist daher die meiste Zeit im Autobusiness ein Tochterunternehmen. Und wie es in einer Familienbeziehung nun einmal ist: Klappt es zwischen Eltern und Kind, ist alles super – klappt es nicht, ist alles nicht super. Müsste ich das Dilemma und die Misere von Opel der letzten 25 Jahre in einen Satz herunterbrechen, wäre es genau dieser.
Opel gehörte einmal zu den richtigen Schwergewichten deutscher Automobilproduktion. Das Kürzel „KAD“ steht für „Kapitän“, „Admiral“ und „Diplomat“ und kennzeichnet einstige Opel-Modellreihen in der Oberklasse, die im Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg zu den Insignien des Wohlstandes gehörten. Wer einen Kapitän fuhr, der hatte nicht einfach nur einen Job, sondern der hatte im Eigenheim eine Einbauküche und Garage, arbeitete festangestellt mit sehr ordentlichem Lohn und hatte das Bedürfnis, diesen Wohlstand auch zu zeigen. Nicht um zu protzen im Sinne wie wir das heute kennen, sondern weil eben vor jedes Reihenhaus ein Auto gehörte. Opel war damals eine feste Hausnummer, wie sich mit seinen deutschen Wettbewerbern Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz messen lassen konnte.
Um die nächsten Jahre mal schnell auf Punkte zu bringen:
- Die Modellreihen wurden zunächst amerikanischer, es grüßen Weiterentwicklungen z.B. eben der KAD-Reihe, allesamt in den B-Modellvarianten, die deutlich großzügiger, „protziger“ waren. Was allerdings schon damals immer weniger funktionierte und heute gar nicht mehr: Der automobile Zeitgeist in Europa tickt grundlegend anders, als in den USA.
- Nach dem KAD-Zeitalter begann die Zeit der Rekords, Asconas, Kadetts, die zwar allesamt funktionierten, aber von Modellreihe zu Modellreihe nur einen Weg kannten: In die automobile Langeweile. In den 1970er bis 1990er Jahre kannte man von Opel in Sachen Emotionalität gerade einmal drei Modelle: Der Opel GT (der ironischerweise dann in den USA mehr Erfolg hatte, als in Europa), der Opel Manta (wissen wir alle, wie die Emotionalität da zu bewerten ist) und der Opel Calibra (den heute nur noch die wenigsten kennen). Opel war das, was Schauspieler Fahri Yardim in einem weiteren #umparkenimkopf-Spot in einen Satz packt: „Ich dachte immer, Opel wird grundsätzlich erstmal in Beige geliefert.“
- Irgendwann kam dann jemand auf die Idee, einen Mann namens José Ignacio López de Arriortúa bei Opel als Manager einzustellen. Der nach ihm benannte Begriff „Lopez-Effekt“ funktioniert noch heute als Schlüsselwort, um bei jedem altgedienten Teilechef oder Werkstattmeister einer Opel-Werkstatt (oder auch später VW) sofortiges Herzrasen auszulösen. Der Lopez-Effekt beschreibt nämlich die Entwicklung in der Fahrzeugproduktion, bei der durch ständiges Einsparen beim Einkauf und der Produktion selbst bei inzwischen stabilen Modellen zwangsläufig die Qualität so weit sinkt, dass zwar das Auto noch einwandfrei verkauft werden kann und auch eine Weile problemlos funktioniert, sich dann aber Qualitätsmängel so massiv melden, dass modellweit aufwendige Reparaturen überdurchschnittlich notwendig werden und sich dieses Image auf die gesamte Modellreihe und gar die gesamte Marke verteilte. Opel war in den 1990er Jahren vor allem ein Synonym für Langeweile und für ärgerliche Unzuverlässigkeiten.
- Nachdem das Image von Opel dann ab Mitte der 1990er Jahre nahe dem Nullpunkt war, begann die Zeit der Fehlentscheidungen. Neue Modellreihen waren weiterhin langweilig, der Lopez-Effekt beschäftigte Werkstätten und Opel noch über Jahre hinweg und der Opel-Vorstandsposten wurde ein Durchreicheposten, ein heißer Stuhl. Wer hier, vornehmlich von der GM-Unternehmensleitung aus Detroit abkommandiert, hineingesetzt wurde, hatte nichts zu lachen. Opel-Chef war ein Job für die ganz Harten der Branche, die wenigsten blieben lange, wie wenigsten konnten überhaupt Deutsch sprechen und kamen mit den Mentalitäten der Opel-Mitarbeiter, -Autohäuser und -Kunden nicht zurecht – wenn sie es denn überhaupt wollten.
- Es kam dann 2009 so, wie es kommen musste: General Motors selbst kam im schwere Turbulenzen und musste in der damaligen globalen Wirtschaftskrise mit vielen Milliarden US-Dollar von der US-Regierung gerettet werden. Wer damals sarkastisch bei Opel unterwegs war, konnte zumindest sagen, dass es für Opel kaum noch schlimmer hätte kommen können. Immerhin schaffte man es, dass Opel weder verkauft werden musste, noch dass Opel zerschlagen wurde oder selbst pleiteging.
- Ab 2010 war ein Sanierungskurs angesagt, bei General Motors und unter anderem auch bei der Tochter Opel. Auch das nichts neues, wenn auch dieses Mal schmerzhaft, denn der Weg von Opel führte (und führt) in die Produktion außerhalb Mitteleuropas. Die Automobilproduktion im Opel-Werk Bochum wird ab 2015 Geschichte sein, so dass mit Rüsselsheim, Eisenach und Kaiserslautern nur noch drei Produktionsstandorte in Deutschland verbleiben.
Das mal ganz kurz zu Aspekten der Opel-Geschichte, die heute die Marke Opel immer noch beeinflussen. Wer näheres dazu lesen möchte, liest den Wikipedia-Artikel zu Opel oder das ganz unscheinbar daherkommende, aber sehr gut informierte Blog About Opel.
Wichtig ist jedoch: Auch wenn General Motors lange Jahre aus Sicht von Opel bzw. der deutschen Konsumenten vor allem das Image der strengen Mutter bewahrt hat, ist Opel nicht einfach nur eine Tochter, sondern ein wichtiger Teil des GM-Verbundes. Das europäische Entwicklungszentrum von General Motors ist in Rüsselsheim, so dass viele Entwicklungen im GM-Konzern ihren Ursprung tatsächlich in Deutschland haben. Auch dieser Umstand ist ein Grund dafür, dass Opel immer noch zum GM-Konzern gehört und Opel-Entwicklungen auch in anderen GM-Marken und Märkten eingesetzt werden.
Und auch die unheilvolle Vermutung, dass Opel nur auf europäische Märkte festgesetzt sei, ist nicht viel mehr als ein Gerücht. Opel gibt es auch in außereuropäischen Märkten und ist dort mitunter auch recht erfolgreich. Ein Konzernverbund hat aber gerade den großen Vorteil, dass man eben nicht unbedingt überall mit einem eigenen Händlernetz präsent sein muss, wenn man erfolgreich sein will. Wenn Opel also in China nicht sonderlich gut funktioniert, zieht man sich also dort ebenso zurück, wie derzeit in Europa weitgehend die Marke Chevrolet zurückgenommen wird. Ein Schritt, der in Europa letztlich Opel und der Schwestermarke Vauxhall zugute kommt. Solche Markenschwerpunkte machen alle anderen Autokonzerne ausnahmslos genauso.
Opel heute.
Nennen wir es einmal „Opel 2.0“, was Opel heute darstellt. Ich habe das Glück, dass ich meine Beratertätigkeit für das besagte Opel-Autohaus in Pforzheim im Jahr 2010 begann, just zu dem Zeitpunkt, als Opel den überarbeiteten Meriva präsentierte. Ein Auto der Generation „Opel 2.0 beta“, die mit dem Opel Insignia 2008 begann. Ein qualitativ sehr guter Minivan, rückblickend gesehen sehr wertstabil, mit innovativen Innenraumkonzepten versehen und mit den gegenläufig öffnenden Türen ein Hingucker. Die neuen Linien bei Opel sind geschwungener, markanter und einheitlicher, das unbeholfen wirkende Kantige bei Modellen ab 2008 weitgehend Geschichte. Und auch den Lopez-Effekt ist weitgehend ausgemerzt, da Opel die Qualität wieder im Griff hat und mit aktuellen Modellen auch wieder positiv in Pannenstatistiken auftaucht.
Was man Opel zugute halten muss: Sie haben vieles nachzuholen, was bei anderen bereits Normalität ist. Ich musste beispielsweise letztes Jahr auf der IAA bei Audi über deren adaptive Lichtkonzepte staunen und merkte schlagartig, dass Opel zwar zu diesem Zeitpunkt eine wieder stark aufstrebende Automarke wurde, aber das der Weg noch weit ist. Neue Technik braucht neue Modelle. Neue Modelle brauchen Entwicklungskapazität. Entwicklungskapazitäten brauchen Vorlauf und Innovationen. Das alles nach Jahrzehnten des Stillstandes und der praktizierten Oberflächlichkeit zu ändern, ist eine unmenschliche Leistung.
Im März letzten Jahres übernahm ein Mann den Opel-Vorsitz, dem man das am Anfang gar nicht so recht zutrauen mochte: Ein einstiger VW-Manager namens Karl-Thomas Neumann. Man staunte mehrfach: Ein Deutscher als Opel-Chef? Ein ehemaliger VW-Manager? Der bei GM im Verwaltungsrat auch tatsächlich etwas sagen kann? Das sind Voraussetzungen für einen Job, den man entweder sehr gut machen kann oder sehr schlecht. Neumann macht ihn gut. Er liefert nicht nur warme Worte, sondern er liefert neue Modelle, neue Innovationen und vor allem legt er Messlatten, deren Erfüllung harte Arbeit bedeuten, die man aber erfüllen kann. Das beweisen eine Reihe von neuen Modellen wie z.B. dem Opel Mokka (Mini-SUV) oder dem Opel Adam (Kompaktklasse Lifestyle), aber auch so bemerkenswerte Konzeptautos wie den Opel Monza Concept.
Dass Opel alternative Mobilitätskonzepte liefern kann, zeigte man 2011 mit dem Opel Ampera, dem ersten elektrisch fahrenden und alltagstauglichen Auto. 60 bis 80 Kilometer über die eingebaute Batterie und ab da dann mit Strom, der von einem zusätzlich eingebauten Benzinmotor und einen dazwischenliegenden Generator angetrieben wird. Zwar basiert der Opel Ampera auf das Schwestermodell Chevrolet Volt, der schon seit 2009 im gleichen Chevrolet-Werk in den USA gebaut wird, wie der Ampera, aber – beide Modelle basieren auf einer Antriebsplattform, deren Entwicklung aus Deutschland kommt.
Überhaupt steht und fällt die nähere Zukunft von Opel nicht mit der Haube, sondern unter der Haube. Viele neuen Modelle leiden vor allem an den etwas betagten Motorengeneration, die Opel heute noch verbaut. Der Opel Adam beispielsweise ist ein witziges, unterhaltsames, durchdachtes Kompaktauto, das es inhaltlich problemlos mit seiner erheblich teureren Konkurrenz aufnehmen kann. Die aktuelle Generation kennt aber weder einen Turbomotor, noch Automatikgetriebe. Beides will Opel zwar nachliefern und das steht auch schon weitgehend in der Pipeline, aber dennoch zeigte das Fehlen von Turbo und Automatik zu Anfang des Opel Adam im Jahr 2013, dass hier noch geliefert werden muss. Zumindest kann man sich aber inzwischen darauf verlassen, dass Opel liefern wird und wenn man sich die neue Motorengeneration anschaut, die im Opel Insignia Sports Tourer (der Insignia-Kombi) verbaut wird, dann sieht man spätestens dort, dass es Opel mit der Einhaltung der EU-Vorgabe von maximal 100 Gramm CO2 pro Kilometer ernst meint. An dem knallharten Wettbewerb zur Einhaltung der EU-Grenzwerte beteiligen sich keine toten Pferde.
In Sachen Infotainment setzt Opel auf das IntelliLink- bzw. MyLink-System, das Panasonic und LG Electronics exklusiv für General Motors produzieren und das bei Opel im Opel Adam zuerst vorgestellt wurde. IntelliLink lässt sich mit Smartphones vernetzen, bietet Zugriff auf die Mediatheken und integriert eine eigene Navigationslösung, die primär auf den Smartphones installiert wird. IntelliLink selbst ist dabei ein Zwischenschritt zu einem System namens OnStar, das zukünftig neben der Vernetzung von Smartphones auch LTE/4G-Einbindung ermöglicht und so auch die zukünftig erforderlichen Notfall-Alarmierung übernimmt.
Opel morgen.
Wir Leute, die Opel bewerben, sind inzwischen abgehärtet und wir sind eine Diskussion los – ob es Opel morgen noch geben wird. Diese unsäglichen und von morbidem Gänsehautfeeling untermalten Gesprächsthemen gibt es nur noch in sehr wenigen Beratungsgesprächen. Bis 2018 will Opel 27 (!) neue Modelle und 17 neue Motoren vorstellen, was praktisch die gesamte jetzige Modellpalette betrifft. Und auch der Opel Ampera, der selbst vier Jahre nach seiner Vorstellung zum aktuellen Stand der Elektromobilität gehört, wird einen elektrischen Nachfolger bekommen, der dann mit deutlich größerer Batterielaufzeit glänzen wird und mit einem modernen Motor.
Opel ist daher weder tot, noch stagniert Opel. Das, was kommen wird, kenne ich selbstverständlich selbst kaum im Detail, aber das, was wir schon lesen und hören können, liest sich gut. Das Ziel, das Karl-Thomas Neumann vorgibt und nicht weniger beinhaltet, als dass Opel bis 2022 zum zweitstärksten PKW-Lieferanten wachsen soll, ist ambitioniert, aber das Vertrauen ist wieder da, dass man das packen kann. Und das beinhaltet auch die Lösung des größten Problems:
Das Blei in den Köpfen
Wer glaubt, die #umparkenimkopf-Kampagne sei einfach nur witzig, hat eines dabei möglicherweise vergessen: Die Kampagne ist überlebensnotwendig gewesen. Das beste Auto kann nicht an Mann oder Frau gebracht werden, wenn Mann oder Frau nicht wenigstens ein Stückweit an die Marke und das Auto glauben wollen, was sie da kaufen sollen. Ein sehr einfacher Grundsatz des Marketings, den man aber erst einmal umsetzen muss. Und den Marketingvorstandsfrau Tina Müller gut und treffend umgesetzt hat und der vor allem auch den Opel-Autohäusern die Chance gibt, darauf einzusteigen.
Umparken im Kopf ist daher ein Titel für eine Kampagne, die eigentlich gleichzeitig auch die Kampagne selbst ist. Man muss die Marke, die man vertritt, präsentieren, ehren, hegen und für sie stehen, in guten und schlechten Zeiten. Denn das sieht auch der Konsument, für den zwar die harten Faktoren wie Leistung und Preis zählen, aber auch die weichen. Der klassische Opel-Käufer (von Neuwagen) ist immer noch der Pragmatiker und ein Mensch der täglichen Praxis. Und den muss man erst einmal wieder von der Marke überzeugen und ihm die Modellpalette nahbar machen. Machen wir im Kleinen, macht Opel im Großen.