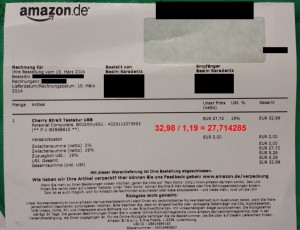Vermutlich hat jeder, der in einem Social Network ist, irgendwann einmal das „Vergnügen“, offenem oder latenten Rassismus entgegenzublicken. Der ein oder andere hat da so seine „Pappkameraden“ in seiner Freundesliste, manchmal kommen auch neue hinzu, oftmals ist Rassismus versteckt und oft genug für den Autoren auch gar nicht so ersichtlich. Russen-/Juden-/Türken-/Italienerwitze sind schließlich weit verbreitet. Und was vielleicht für den einen halbwegs witzige Monologe sind, sind für den anderen schon haarscharf an rassistischen Äußerungen.
Gut, man muss bei allem, was man liest, eine liberale Lesehaltung anwenden. Aber wie geht man mit dem „alltäglichen“ Rassismus in einem Social Network um? Nun gibt es prinzipiell vier Möglichkeiten, mit latentem Rassismus in seiner Timelime umzugehen:
- Man überliest es einfach und lässt es durchlaufen. Wird schon nicht so schlimm sein.
- Man liest es, ärgert sich und kommentiert es entsprechend mehr oder weniger scharf protestierend.
- Man liest es, ärgert sich vielleicht darüber und blendet den Autoren eines solchen Statements aus. Das geht z.B. in Facebook, da dort jede Freundschaft gleichzeitig auch ein Abonnement der Beiträge des jeweiligen Freundes ist und man dieses Abonnement der Beiträge auf der Profilseite des Freundes gesondert beenden kann.
- Man entfernt den Freund aus der Freundschaftsliste, gleichzeitig ist damit auch das Abonnement der Beiträge beendet.
1. Überlesen.
Klar ist, dass für Demokraten der Punkt 1 kaum tragbar ist. Man kann es vielleicht mal durchgehen lassen, wenn man weiß, dass die Äußerung ironisch oder sarkastisch gemeint ist, aber auch das ist schon reichlich problematisch, denn zu einer Äußerung gehört neben einem Autor auch immer ein Leser. Der eine fasst es als Ironie bzw. Sarkasmus auf, der andere lässt das in sein Meinungsbild als echte Meinung gelten.
Dennoch: Überlesen und wissentlich ignorieren ist zwar bequem, aber per se nicht gut. Oftmals merkt ein Freund gar nicht so recht, dass er mit einer Äußerung Freunde verletzt (sowas gibt es tatsächlich), da wäre ein Aufbegehren sicherlich nicht verkehrt. Das kann man ja auch erst einmal in einer privaten Mitteilung tun.
Schwerer wird es, wenn solche Äußerungen nicht der Einzelfall bleiben, sondern immer wieder abgefeuert werden. Spätestens da ist Weghören ein falscher Weg. Steter Tropfen höhlt jeden Stein.
2. Der kleine-große Protest.
Punkt 2 ist dann der Weg des „kleinen Protestes“, in dem man aufbegehrt und den Autoren einer rassistischen Äußerung zur Rede stellt. Das kann man machen und das ist sicherlich auch ehrenvoller, aber man muss damit rechnen, ein Echo zu bekommen. Das kann der Autor selbst sein, was allerdings eher selten der Fall ist, wenn man mit dem Autor gut befreundet ist. Möglicherweise kommt hier auch schon der Protest insofern gut an, dass es den Autor zum Nachdenken anregt.
Problematischer hingegen ist bei Punkt 2, dass sich möglicherweise andere Mitleser genötigt fühlen, dem Autor der rassistischen Äußerung zur Hilfe springen zu müssen. In der Regel knallt es spätestens jetzt verbal, denn hier gehen bei vielen der Gäule durch, meist auch gleich mit dem kompletten Repertoire der vermeintlich Unterdrückten … von „man wird doch wohl mal sagen dürfen“ bis hin zum angeblich notwendigen Kampf gegen das „Gutmenschentum“, um das Volk zu retten und so weiter. Es ist bisweilen erschreckend, was hier schlagartig an verbalem Gewaltpotential losgelassen wird und man muss sich als Protestler auf größere Schimpfkanonaden einstellen.
Von solchen Kanonaden sollte man sich tunlichst nicht provozieren lassen und möglichst auch gar nicht antworten. Zu einer unsachlichen Diskussion gehören immer mehrere und leider gilt auch in Social Networks das Phänomen, dass viele Teilnehmer in besonders emotionalen Diskussionen jegliche gute Erziehung vergessen lassen, in dem sie vorübergehend vergessen, dass hinter ihren Bildschirmen auch Menschen sitzen. Wenn es ein Echo gibt und man auf das Echo reagiert, dann reagiert man praktisch nie auf das eigentliche Problem (dazu hat man ja schon etwas geschrieben), sondern lässt sich auf eine verbale Gewaltspirale ein.
3. Ausblenden.
Das Ausblenden von allen Beiträgen eines Freundes ist nicht in jedem Social Network technisch problemlos möglich. Wenn es aber möglich ist, ist es ein relativ bequemer Schritt, von einem permanenten Störenfried Ruhe zu haben, ohne ihm gleich im Network die Freundschaft kündigen zu müssen. Man liest dann schlicht und einfach den Unfug nicht mehr – das restliche Geschriebene und Veröffentlichte dann allerdings auch nicht mehr.
Um des Friedens Wille ist das der beste Weg, aber, ganz offen gesagt, auch der inkonsequenteste. Warum soll ich für mich etwas bei meinen Freunden in einem Social Network durchlassen, was mich so sehr stört, dass ich alles dafür tun muss, sie komplett auszublenden? Und warum muss ich als Freund in einer möglicherweise großen Freundesliste dafür stehen, so jemanden als Freund zu schätzen?
4. Das Überschreiten einer Grenze und das Ziehen von Konsequenzen.
Nein, das muss man nicht. Wer in einem Social Network herumstänkert und rassistisch herumtönt, überschreitet Grenzen deutlich und das stärker und auffälliger, als man eigentlich durchgehen lassen kann. Wenn so jemand in einem Restaurant Zoten in einer ähnlichen Brandklasse loslassen würde, würde ich mich beschweren. Würde ein Freund solche Dinger mir gegenüber aushusten, würde ich aufstehen und gehen. Und das gleiche sollte man auch in Social Networks tun. Aufstehen und gehen. Also „entfreunden“, „unfollowen“, den Bezug löschen.
Das ist mitunter eine schwere Entscheidung, die in einem größeren Freundeskreis Fragen aufwerfen und schlechte Stimmung erzeugen. Aber da stellt sich immer die Frage, wer damit angefangen hat. Offen gelebter Rassismus, also im Grunde genommen praktizierter Menschenhass, ist inakzeptabel. Auch in einem sozialen Netzwerk, egal ob das in der Kneipe ist, auf einer Geburtstagsparty oder in einem Social Network.