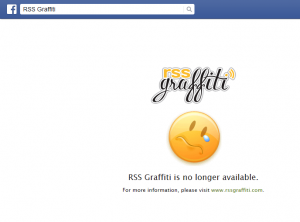Unter den Flugsimulator-Freunden gibt es ungefähr seit den Anschlägen auf das World Trade Center in New York einen ungeschriebenen Ehrenkodex: Spekuliere in echten Katastrophenfällen mit Flugzeugen nicht als „Flugexperte“ mit, niemals. Wir Flugsimulatorleute haben ein spannendes Hobby, fliegen virtuell auch Großflugzeuge, die sich recht realistisch verhalten, aber doch nur vereinfacht steuern lassen, weil einfach eine Vielzahl von Instrumenten nicht simuliert werden (können). Zwar kann man mit modernen Simulatoren Instrumentenflüge simulieren, per Autopilot auf Flugpläne fliegen und sogar per Instrumente automatisch landen, aber die Realität geht weiter. Da kommen noch viel mehr Dinge dazu, die beachtet werden müssen und letztlich hat man bei einem echten Flugzeug hinter sich nicht einfach nur die Zimmerwand, sondern hunderte Passagiere sitzen. Es ist ein Unterschied, ob man 500 echte Flugstunden hat oder 500 Stunden am PC-Flugsimulator, selbst wenn man alles gelandet bekommt.
Ich will daher auch gar nicht den Flugunfall der Germanwings-Maschine bewerten, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Ich kann jedoch kurz erklären, wie eigentlich moderner Flugverkehr funktioniert und was ich für Fragen daraus habe.
IFR versus VFR.
„IFR“ steht für „Instrument Flight Rules“ und steht im Gegensatz zu „Visual Flight Rules“. Letzteres ist das, was kleinere Flugzeuge auf kleineren Flughöhen tun, nämlich Fliegen auf Sicht und weitgehend ohne Instrumente. Alles, was höher als ca. 6000 Fuß fliegt, fliegt nach Instrumenten und darf überhaupt erst in diese höheren Flugebenen mit höheren Geschwindigkeiten fliegen und, das ist das wichtigste, in Wolken hineinfliegen.
IFR bedeutet aber auch, dass nicht jeder so fliegen darf, wie er kann, sondern dass Flugstraßen benutzt werden müssen. Diese einzelnen Straßen enden nicht unbedingt an sichtbaren Orten, sondern entweder an Flugsteuerungsanlagen auf der Erde oder sogar nur auf virtuellen Punkten wie z.B. auf Meeren und Ozeanen. Wichtig aber ist, dass diese Flugstraßen peinlichst genau geflogen werden müssen, mit nur sehr wenigen und berechtigten Ausnahmen.
Diese Ausnahmen müssen von Piloten in Absprache mit der jeweils regional zuständigen Flugsicherung abgesprochen werden, was der nächste wichtige Punkt von IFR-Flügen ist: Ohne Flugsicherungskontakt kein IFR. Die Flugsicherung muss immer wissen, welche Flugzeuge nach IFR in seiner Region wo genau fliegen. Das wird per Radar und Flugfunk überwacht, aber auch durch die Flugpläne, die vorab von Fluggesellschaften und Crews eingereicht werden.
Flugplan und Autopilotieren.
Was viele Passagiere nicht wissen: Die allermeisten Flüge werden weitgehend automatisch absolviert, vom Start bis zur Landung. Beim Start läuft es in der Regel so, dass erst einmal auf Geschwindigkeit gekommen werden muss, dann wird abgehoben und mit einer bestimmten Steigrate nach Ansage des Flughafentowers in eine bestimmte Richtung geflogen. Mit dem Ziel, möglichst zügig auf die vorher von der Crew eingereichte Flugstraße zu kommen. So bald die erreicht wird, übergibt die Flugsicherung üblicherweise die Navigation an die Crew, die dann den vorher einprogrammierten Flugplan abfliegt. Ab diesem Moment fliegt dann das Flugzeug nicht nur auf Autopilot, sondern auch nach dem Flugplan.
Das geht dann so weiter bis das Flugzeug in die Nähe des Zielflughafens kommt, da läuft das dann quasi rückwärts ab. Die Flugsicherung teilt einen Anflug zu und bringt das Flugzeug in die Nähe des Landebahnanflugs. Hat der Flughafen ein Landesystem („ILS“) und ist das Flugzeug entsprechend ausgestattet, kommt pure Magie ins Spiel, denn damit lässt sich ein Flieger praktisch auch vollautomatisch landen, bei Wind und Wetter, bei Nacht und Nebel. Natürlich hat die Crew immer die Entscheidungsgewalt und kann jederzeit eingreifen und Landungen und Autopilot abbrechen, aber moderner Flugbetrieb würde ohne diese Instrumentenflüge nicht funktionieren können.
Einfach mal verfliegen, falsche Route oder Höhe?
Dank Flugsicherung würden solche Dinge bei IFR-Flügen sofort auffallen und üblicherweise interveniert die Flugsicherung auch sofort per Funk, wenn ein IFR-Flug „danebenfliegt“. Flugebenen sind nach 1000-Fuß-Schritten eingeteilt und üblicherweise fliegen Flugzeuge exakt auf beispielsweise 39.000 Fuß, wenn sie das sollen. 100 Fuß darüber oder darunter gibt schon Anlass zu Korrekturen, je nachdem, wie pingelig die Flugsicherung ist und welche Umstände vorliegen. Ähnliches gilt für die Route, wenn diese nicht dem eingereichten Flugplan entspricht. Ohne vorherige Anmeldung der Routenänderung muss man als Pilot schon eine sehr gute Begründung haben, wenn man die Route eigenmächtig ändert und da geht es schon um wenige Grad. In Mitteleuropa ist der Flugverkehr in vielen Regionen derart dicht, dass jedes „danebenfliegende“ Flugzeug unter Umstände eine Reihe von Korrekturen bei anderen Flugzeugen nach sich ziehen muss, denn die Flugsicherung will ja die Sicherheitsabstände unter den Flugzeugen möglichst groß halten. Es ist auch so, dass Piloten mit ihrer Lizenz spielen, wenn sie die Spielregeln nicht einhalten und letztlich auch strafrechtlich haftbar sind.
Was passiert, wenn der Autopilot Amok läuft?
Das passiert eher selten, was aber eben auch nicht unmöglich ist. Computer sind nur so gut, wie sie programmiert werden. Großflugzeuge besitzen aber eine Reihe von unterschiedlichen, sich gegenseitig kontrollierende Computer, die auch von unterschiedlichen Teams programmiert wurden. Und zudem kann jeder Verkehrspilot grundsätzlich seinen Vogel auch ohne Autopilot zur Erde zurückbringen, rein mit dem Flugfunk (und zur Not auch ohne das und nur mit Karte).
Es gibt da einen kleinen Unterschied bei Airbus-Flugzeugen, denn Airbus setzt bei seinen Großflugzeugen stärker auf das „computer aided“ Fliegen, was man schon mal daran erkennt, dass Airbus-Flugzeuge kein Steuerhorn haben wie andere Flugzeuge, sondern nur noch einen Joystick für jeden Piloten. Die Idee dahinter ist, dass die Steuerbefehle der Piloten nicht direkt an die Ruder gehen, sondern durch einen Computer laufen, der darauf achtet, dass gefährliche Steuerausschläge nicht oder nur gedämpft durchgeführt werden. Da kann man Sorge davor haben, dass der Kollege Computer da immer dazwischensteht, aber letztlich sind hier auch immer mehrere, voneinander unabhängige Steuerungssysteme am Werk, die sich auch permanent überwachen.
Da war doch mal was mit eingefrorenen Sensoren.
Stimmt und das war auch bei Airbus-Flugzeugen. Beispielsweise das Einfrieren eines Staurohres. So ein Staurohr wird benötigt, um während eines Flugs die Geschwindigkeit ermitteln zu können. Friert so ein Sensor ein, gibt es möglicherweise keine korrekten Werte mehr in den Bordcomputer und möglicherweise reagiert das Flugzeug dann mit Maßnahmen, die eigentlich nicht erforderlich sind, weil das Flugzeug schnell genug fliegt, aber eben nur der Sensor falsche Daten liefert.
Im Prinzip kann das aber bei jedem automatisch fliegenden Flugzeug passieren, denn ein Autopilot funktioniert ja nicht nur so, dass starr in eine Richtung geflogen wird, sondern es wird ständig korrigiert. Der Wind ist dabei der größte Störungsfaktor und das Flugzeug muss ja dennoch fest auf seiner Route bleiben. Spinnt ein Sensor (und das tun Sensoren immer wieder einmal), muss eine Crew das beurteilen können und darauf reagieren. Mitunter auch mit dem Ignorieren der Werte dieses Sensors und einem Ermitteln von anderen Werten, um dessen Funktion anderweitig zu kompensieren. Das ist alles in den meisten Fällen auch reine Routine und wird auch regelmäßig geübt.
Verkettungen.
Blöd wird es, wenn sich Umstände verketten und schnell reagiert werden muss. Oder die Crew ausfällt. Zu den richtig üblen Sachen gehören noch nicht einmal die Dinge, von denen die meisten Menschen Angst haben (Flügel brechen nicht einfach so ab und selbst wenn alle Triebwerke ausfallen, segelt auch ein Großflugzeug noch ganz passabel viele Kilometer weit), sondern vor allem der Faktor Zeit. Entscheidungen müssen in wenigen Minuten gefällt werden, dazu braucht die Crew schlagartig hundert Prozent ihres Verstandes, es müssen Entscheidungen eingeholt werden und dann muss man auch noch Ablaufpläne abarbeiten und zuschauen, ob das Problem nicht noch größer wird. Und nicht zu vergessen: Man kann auch dann nicht fliegen wie der Teufelsflieger vom Sportflugplatz, denn wir haben ja noch Passagiere hinten mit draufsitzen.
Modernes Fliegen ist die meiste Zeit Routine und in diesen Momenten ist selbst Busfahren mit mehr Stress verbunden. Spannend wird es dann, wenn etwas nicht nach Plan läuft.
Die Fragen der Fragen.
Richtig wichtig sind natürlich vor allem die Fragen, was die Begründung war, dass die Germanwings-Maschine acht Minuten vor dem Absturz seine Reiseflughöhe von 39.000 Fuß verlassen hat und mit Reisefluggeschwindigkeit, aber eben mit fast konstanter Sinkflugrate fast 140 Kilometer weit flog. Das ist nichts, was keinem Crewmitglied nicht auffällt und acht Minuten sind eine sehr lange Zeit, um zu kommunizieren und gegebenenfalls einen Autopiloten zu deaktivieren.
Üblicherweise ist es auch so, dass bei einem ernsten Problem eine Crew als erstes zuschaut, sich von einer eher „ungemütlichen“ Region fernzuhalten. Gibt es bei einem IFR-Flug also ernste Probleme, die möglicherweise eine Notlandung nötig machen, ist der erste Weg die Kontaktaufnahme mit der Flugsicherung, die dann umgehend Routen zu Flughäfen in der Nähe plant und sie dem Piloten anbietet.
Warum also der Sinkflug bis zum bitteren Ende durchgeführt werden konnte und das Flugzeug immer noch mutmaßlich auf seiner einprogrammierten Route flog, ist das größte Fragezeichen.
Wichtig ist auch immer: Eine vollständige Bewertung eines Absturzes ist immer ein sehr großes Bild. Dazu gehören natürlich Flugschreiber und Augenzeugenberichte, Fotos von der Absturzstelle aber auch die vollständige Kommunikation der Flugsicherung und dortige Reaktionen. Das alles so zu interpretieren, dass am Ende ein vollständiger und nachvollziehbarer Bericht entsteht, das dauert Monate.