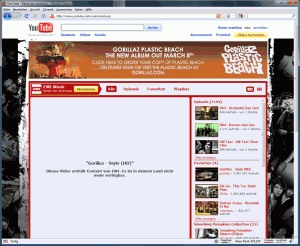Die regelmäßigen Blog-Leser werden sich ja daran erinnern, dass ich in Sachen Sat-Receiver eine halbe Odyssee hinter mir habe. In der Zwischenzeit zähle ich den fünften Sat-Receiver, den innerhalb von fünf Jahren besessen habe und irgendwann erreicht man als jemand, der zwar technisch nicht ganz unbegabt ist, der aber diesen ganzen Sat-Kauderwelsch für höchst unlogisch hält, an seine Belastungsgrenzen. Satellitenfernsehen ist ein technisches Mienenfeld, dass dadurch komplizierter gemacht wird, weil so viele Deppen Sat-Techniker sind und die Techniksprache deshalb vor Anachronismen und Unklarheiten nur so strotzt.
Dass mag noch alles gut sein, wenn man nur Astra empfängt, aber in unserem Fall soll bitteschön auch Türksat zu empfangen sein, weil mein Vater sehr an heimatlichen Programmen interessiert ist. Und da kommt dann noch das Chaos auf dem Türksat-Satelliten hinzu, wie es sich für eine mediterran geprägte Technikkultur eben gehört. Es muss also ein Sat-Receiver her, der zum einen HDTV nach dem DVB-S2-Standard versteht, damit einen HDMI-Ausgang mitbringt und der möglichst einfach zu konfigurieren und später auch einfach zu bedienen ist. Ein Ding der Unmöglichkeit.
Nach wirklich elend langer Recherche bin ich Ende Sommer 2009 (ja, so lange steht der Receiver schon bei mir und so lange habe ich darüber nicht gebloggt) auf den TechniSat Digit HD8-S gestoßen und habe das Ding sofort für 299 Euro gekauft.
Und schon beim Kauf beginnen die Abgrenzungen zum sonstigen Elektroschrott, der sich als HDTV-fähige Sat-Receiver in den Regalen breitmacht: Die höherwertigen Sat-Receiver, und dazu gehört der Digit HD8-S, gibt es nicht überall an jeder Ecke zu kaufen, sondern nur bei autorisierten TechniSat-Händlern. Das ist ein Grund dafür, dass es die hochwertigen TechniSat-Modelle in Online-Shops nur in homöopathischen Dosen gibt. Damit will man vermutlich den Einzelhandel stärken, allerdings bringt das auch ggf. den Verdacht mit, dass TechniSat-Modelle unverkäuflich sein. Das ist allerdings ein echter Trugschluss, denn der gekaufte Sat-Receiver ist bis zum heutigen Tage ein guter Kauf.
Auspacken und die Schnittstellen
Der Digit HD8-S bringt alle gängigen Schnittstellen mit, die ein Sat-Receiver heutzutage mitzubringen hat:
2 SCART-Ausgänge, 1 analoger Video-Ausgang (FBAS), 1 analoger Komponentenausgang (3 x Cinch) ein analoger Audio-Ausgang (2 x Cinch), jeweils ein optischer und elektrischer Audio-Digitalausgang, 2 USB-Anschlüsse (vorn und hinten), 1 SD-/MMS-Card-Slot, 1 Compact-Card-Slot, 1 HDMI-Ausgang, 1 Ethernet-Anschluss.
Der Ethernet-Anschluss verspricht übrigens mehr, als er wirklich kann, denn der Sat-Receiver lässt sich zwar problemlos in ein Heimnetzwerk einbinden, über den eingebauten Webserver lässt sich aber nur die Aufnahmeprogrammierung ansteuern und bedienen. Immerhin kann man so von der Ferne aus Sendungen aufnehmen. Zweifellos hätte man aus dem Ethernet-Anschluss aber viel mehr machen können.
Stichwort: Common Interface und (kein) CI+
In Sachen Common-Interface-Schnittstellen gibt es zwei Schächte, die beide nicht für CI+ vorbereitet sind. Und das ist auch gut so, denn das Plus-Zeichen besagt keinesfalls, dass CI+ besser als das normale Common Interface ist, denn CI+ kommt mit Restriktionsmöglichkeiten einher, die es Inhaltsanbietern ermöglicht, Sendungen mit Restriktionen zu belegen, beispielsweise Aufzeichnungsverbote oder fehlende Möglichkeiten zum Überspringen von Werbeblöcken. Merke: “CI+ ist Minus!”
Für Geräte mit normalem Common Interface bedeutet dies im Klartext, dass das Angebot von “HD Plus”, dem Astra-Paket, in dem die Programme von RTL und Sat1ProSieben ausgetrahlt werden, nur mit einem zusätzlichen CI-Modul entschlüsselt werden können und dieses Modul keinesfalls mit allen Sat-Receivern funktionieren wird. Der Digit HD8-S gehört aber zu den Geräten, für das im Laufe des Jahres ein entsprechendes Modul verfügbar sein wird und da der Digit HD8-S keinen CI+-Schacht hat, wird eben auch nicht alles verbotene nicht funktionieren. 😉
Der Digit HD8-S ist also möglicherweise der letzte hochwertige Sat-Receiver von TechniSat ohne CI+, was ihn zweifellos noch interessanter macht, zumal es mit dem Digit HD8+ schon einen potentiellen Nachfolger mit CI+ gibt. Es kann also passieren, dass es den Digit HD8-S so möglicherweise nicht mehr lange gibt.
Installation
Die einmalige Einrichtung ist, man muss es so sagen, idiotensicher. Während wirklich praktisch jeder Sat-Receiver kryptisch einzurichten ist und manuelle Sendersuchläufe notwendig sind, hat TechniSat hier schon vor Jahren aufgeräumt und Maßstäbe gesetzt.
Nach dem erstmaligen Einschalten hat man nur einige wenige Parameter einzustellen: Normale Schüssel oder eine drehbare? Multiswitch? Und danach wird nur noch ausgewählt, an welchem Port des/der Multiswitch(e) welcher Satellit angepeilt wird. Fertig. Der Digit HD8-S prüft anhand hinterlegter Parameter, ob das auch so stimmt. Stimmen sie, ist kein Sendersuchlauf erforderlich, denn die TechniSat-Receiver holen sich über einen eigenen Feed die jeweils aktuellen Programmlisten, die TechniSat zentral pflegt. Das Ding ist also tatsächlich nach fünf Minuten nicht nur empfangsbereit, sondern auch programmaktuell am Start.
Und da TechniSat “made in Germany” ist und man in Deutschland nicht nur ein Drittes Programm hat, sondern mehrere, fragt der Receiver sogar, welches “Dritte Programm” denn das zuständige ist und sortiert das entsprechend. Feinheiten, die allerdings den Vorsprung machen.
Zum Vorsprung gehört auch, dass die Programmlisten regelmäßig aktualisiert werden (ca. 1 Mal im Monat) und auch die Software des Receivers gepflegt wird (ca. alle zwei, drei Monate, Update via Satellit und Internet/USB-Stick).
EPG versus “SiehFernInfo”
Auch in Sachen EPG, dem Elektronischen Programm Guide, setzt TechniSat seinen Stempel auf. Denn während bei normalen Sat-Receivern die Programmzeitschrift jeweils durch den Sender bereitgestellt wird und logischerweise auch nur dann in einer Übersicht erscheinen kann, wenn das jeweilige Programm einmal kurz eingeschaltet wurde, stellt TechniSat einen eigenen Programmguide namens “SiehFernInfo” oder kurz “SFI” zur Verfügung. Und das kostenlos.
Dazu sind die TechniSat-Receiver so eingestellt, dass sie sich jeden morgen um 4 Uhr einschalten und den hauseigenen Feed abhören. Dort werden dann die Programmguide-Inhalte der nächsten sieben Tage geladen und im Receiver hinterlegt, so dass der Benutzer dann jeden Tag eine frische “Programmzeitschrift” hat, die zudem die Programme auch noch thematisch sortiert anzeigen kann.
Aufnahmen
Der Digit HD8-S ist von Hause aus kein Recorder, hat also keine eingebaute Festplatte. Aufgezeichnet werden kann aber trotzdem, wenn ein Datenträger entweder über die SD-/MMC-/Memoystick-/Compact Flash-Card-Schnittstelle eingelegt ist oder per USB ein externes Laufwerk angeschlossen wird. Tut man das, kann auch aufgezeichnet werden und auch der EPG für Aufnahmen verwendet werden.
Ich finde das grundsätzlich praktischer, als eine Aufzeichnung auf eine eingebaute Festplatte, denn in den meisten Fällen will ich Aufzeichnungen am PC gern nochmal nachbearbeiten oder auf DVD brennen und mit einem externen Medium ist der Transport eben kinderleicht und flott. Die Aufzeichnungen erfolgen, wie allgemein üblich, als gekapselte MPEG-Streams, die mit entsprechenden Software-Werkzeugen (beispielsweise ProjectX) extrahiert werden können. Die exportierten MPEG-Streams entsprechen dann zu 100 % dem, was über den Sender gegangen ist.
Die Programmierung selbst ist kinderleicht, der EPG leistet zusammen mit dem SFI-Guide beste Arbeit. Ebenso einfach ist es, eine Aufzeichnung des laufenden Programmes zu starten (ein Tastendruck auf die Record-Taste) und die Aufzeichnung zeitgesteuert enden zu lassen, entweder zum Ende der Sendung oder nach einem einstellbaren Zeitraum. Und während einer Aufzeichnung die Sendung schon mal zeitversetzt anzuschauen, ist ebenfalls möglich.
Nur damit wir es mal angesprochen haben: Der Digit HD8-S ist kein Twin-Receiver, kann also nur ein Programm gleichzeitig empfangen. Wenn man ein Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm anschauen möchte, ist dieser Sat-Receiver nicht das richtige Gerät!
Energieverbrauch
In Sachen Energieverbrauch legt TechniSat eine Messlatte dafür vor, wie moderne Sat-Receiver mit endlichen Ressourcen umzugehen haben. Ich habe zwar gewusst, dass der Digit HD8-S in Sachen Stromverbrauch sehr sparsam ist, die eigenen Messwerte haben mich dann aber doch überrascht:
Im Betrieb zieht der HD8-S 19 Watt Strom aus der Leitung. Das ist erst mal nichts besonderes, mein vorheriger Homecast HS5101 CIUSB schluckte hier mit 20 Watt nicht sonderlich mehr.
Wo wirklich gespart wird, ist beim Standby-Betrieb, denn da gibt es insgesamt drei Varianten:
- “Warmes” Standby (11 Watt), bei dem das Gerät innerhalb kürzester Zeit aufgeweckt werden kann.
- “Kaltes” Standby mit Uhranzeige (1,2 Watt), bei dem der Receiver etwa 10 Sekunden braucht, bis er ein Bild liefert. Im Standby-Betrieb erscheint neben der obligatorischen Standby-Anzeige noch die aktuelle Uhrzeit auf dem Display,
- “Kaltes” Standby ohne Uhranzeige – 0,1 Watt.
Keine Frage, dass mein Digit HD8-S im kalten Standby ohne Uhranzeige ruht, denn mit 0,1 Watt Stromverbrauch schluckt der Sat-Receiver im Standby-Betrieb schlappe 120 mal weniger Strom, als mein vorheriger Sat-Receiver, der sich im Standby-Betrieb inakzeptable 12 Watt genehmigte. Zum Vergleich: Unser Küchenradio verbraucht im Betrieb 1 Watt.
Fazit in wenigen Worten
Nichts für Bastler, dazu ist der Digit HD8-S zu wenig schlecht programmiert oder mit undokumentierten Schnittstellen ausgestattet. Wer einen gut einstell- und bedienbaren Sat-Receiver sucht, der ein brillantes Bild auf den Schirm zaubert, einem das übliche Sat-Gefummel abnehmen soll und im Standby-Betrieb äußerst sparsam ist, ist hier genau richtig. Die beiden Common-Interface-Schächte, die fehlende CI+-Unterstützung und das kommende CI+-Modul machen den Digit HD8-S darüber hinaus auch für diejenigen interessant, die sich für HD Plus interessieren und sich nicht ganz so auf der Nase herumtanzen lassen wollen.