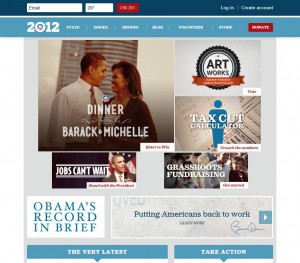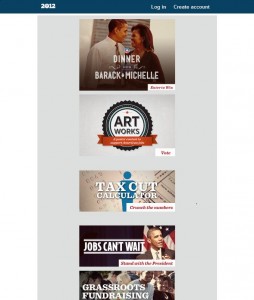Wie jeder wahlberechtigte Baden-Württemberger lag letzte Woche auch in meinem Briefkasten eine Benachrichtigung zur Volksabstimmung zum S21-Kündigungsgesetz im Briefkasten. Und auch wenn die Volksabstimmung aufgrund der weitgehend surrealen Quorum-Anforderung (über deren Anpassung die Opposition pikanterweise nicht mit sich diskutieren lassen wollte) schon im Voraus als praktisch chancenlos angesehen werden kann, darf ich mir erlauben, ein Wort darüber zu verlieren. Ich bin nämlich für den Ausstieg und werde deshalb „Ja“ zu dem Hilfskonstrukt des „S21-Kündigungsgesetzes“ sagen.
Der Grund dabei ist gar nicht mal der Bahnhofsneubau selbst. Ich könnte jetzt sehr egoistisch sein und sagen, dass mir der Stuttgarter Bahnhof so lang wie breit ist, ob nun Kopf- oder Durchgangsbahnhof. Ich bin in meinem Leben keine zwanzig Mal nach Stuttgart per Bahn gereist und gedenke auch nicht, das zukünftig zu ändern. Daran ist weniger der Bahnhof schuld, sondern der Bahnhof in Pforzheim. Von dort dauert nämlich die Anreise nach Stuttgart gut eine Stunde mit in der Regel überfüllten, stinkenden und versifften S-Bahnen, die die Deutsche Bahn zukünftig noch seltener reinigen will.
Und selbst wenn man den offiziellen Argumentationen auf den Leim treten mag – selbst da fällt es einem schwer, nicht lauthals darüber zu lachen. Die „Magistrale Paris-Bratislava“, von der auch heute noch geschwärmt wird, stammt noch aus einer Zeit, in der wir ein Drittel weniger Autos im Lande hatten und ein Flugticket Stuttgart – London noch gut fünfmal so viel kostete, wie heute. Kein Schwein fährt mit der Bahn nach Bratislava und wer nach Paris mit der Bahn fahren möchte, tut das ab Straßburg, weil es erst ab da schnell geht und die Züge der französischen SNCF nicht ganz so verrotzt sind, wie die der Deutschen Bahn.
Nein, der Bahnhof in Stuttgart ist nicht das wirkliche Problem für mich. Ich könnte S21 vielleicht sogar gut finden, wenn die Rahmenumstände nicht so dermaßen schlecht wären. Es ist die Art und Weise, wie die Idee des Bahnhofes zu einem konkreten Projekt geworden ist. Mit realistischen Fakten und Zahlen hat dieser Bahnhofsneubau nämlich schon lange nichts mehr zu tun, wenn es denn überhaupt einmal realistische Fakten und Zahlen gegeben hat.
Der Bahnhofsneubau ist einer der Paradebeispiele, wie in Baden-Württemberg in den letzten Jahrzehnten vornehmlich Spitzenpolitik betrieben wurde. Machtbewusst, unternehmerfreundlich, ein bisschen korrupt und das Volk, das ja eigentlich die eigentliche Macht im Staate darstellt, hatte eifrig zu schaffen, da ja Häusle zu bauen waren. Die CDU, die FDP und in weiten Teilen auch die SPD haben es sich im Landtag sehr, sehr gut gehen lassen. Hier und da wurde etwas öffentlichkeitswirksam gestritten, aber sich so richtig gegenseitig wehtun, nein, das wollte man dann doch nicht. Dass man mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Milliarden Euro, die so ein Bahnhof und die vielen anderen Projekte, die man gern damit verheiraten will, kosten wird oder noch kann, im Ländle an vielen Stellen sehr sinnvolle Dinge machen könnte, das ficht im Landtagsbunker in Stuttgart offenbar niemanden, so lange der Zwiebelrostbraten in der Kantine für alle da ist.
Das ist das Problem. In einer immer stärker auseinanderbrechenden politischen Landschaft, in einer immer stärker vernetzten und kritischer werdenden Bürgerschaft, die fälschlicherweise von Politikern gern als „Wutbürgertum“ abgestempelt wird, funktioniert zwar immer noch sehr vieles – aber nicht mehr alles einfach so im Hinterstübchen, in kleinen Zirkeln und Küchenkabinetts, bei ein bis zehn Gläschen Trollinger oder Schlimmerem.
Man könnte die letzte Landtagswahl im März diesen Jahres als so ein Signal auffassen. Und wenn man es sehr genau analysiert, hat insbesondere die SPD nur deshalb den Notsitz in der Regierung bekommen, weil es nichts anderes gab. Die SPD profitiert in Baden-Württemberg schon lange nicht mehr davon, wenn der „Wutbürger“ die Nase voll von der bisherigen Spätzleswirtschaft hat. Profitieren tun hier vor allem die Parteien, die sich hinstellen und sagen: So nicht. Oder zukünftig so Parteien, die sogar richtig stolz darauf sind, erst gar kein Parteiprogramm zu haben.
Nun macht man es sich als Machtpolitiker der Alten Schule vor allem erst einmal sehr einfach, wenn man die Grünen als die „So-Nicht-Partei“ abstempelt, die „Dagegen-Partei“. Das macht der konservative Sektor der CDU- und FDP-Truppen liebend gern. Denn tatsächlich fällt diesen so fahrlässig abheftenden Menschen nichts besseres ein, wie sie aus ihrem Dilemma wieder herauskommen.
Gegen was sind denn die Grünen? Gegen Modernität? Wohl kaum, wenn man sich anschaut, dass nun selbst unsere Bundesregierung (ja, CDU, FDP und noch etwas CSU) aus der Kernenergie aussteigt. Plötzlich Mindestlöhne gut findet. So als ob Union und FDP schon immer sehr an der Umwelt gelegen war und sich besonders stark für den Sozialstaat eingesetzt hätte.
Gegen etwas dagegen zu sein, hat erst einmal nichts mit Wutbürgertum zu tun und schon gar nicht mit Technikfeindlichkeit oder Zukunftsverweigerung. Dagegensein hat erst einmal damit zu tun, dass man Dinge ablehnt und das möglicherweise deshalb, weil man nicht versteht, was sie eigentlich bezwecken. Wie Ideen entstanden sind. Wie sie durchgeboxt worden. Was sie überhaupt kosten.
Der Stuttgarter Bahnhofsneubau ist weit davon entfernt, eine der Öffentlichkeit bekannte und vor allem wirklich realistische Finanzierung aufzuweisen. Zahlen wurden geschönt, es gab „bedauerliche Rechenfehler“, mal wurde angeblich Euro mit Deutscher Mark verwechselt und es vergeht inzwischen keine Woche mehr, in der nicht irgendeine Tageszeitung und gar der ehrwürdige SPIEGEL darauf verweisen, dass schon wieder einmal ein Aktenordner mit Zahlen nicht präsentiert wurde und in irgendeinem Ministerium mit Geheimhaltungsvermerk vor sich hinschimmelt. Das sind keine Bagatellen, hier wurde systematisch vertuscht, geheimgehalten, herumgewurstelt, gelogen.
S21 war nie geliebt, wurde von Anfang an legendär-schlecht der Bevölkerung angepriesen, hat irgendwann jegliche Projektierungsgrenzen gesprengt und wird nun mit aller Gewalt durchgedrückt, was die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht wirklich steigert. Sagen wir es deutlich: S21 ist so tot, dass es noch toter gar nicht mehr geht.
Tote, so sagt man, lässt man besser ruhen.
Aus diesem Grund: Nein zu S21 und ein deutliches Ja zum S21-Kündigungsgesetz. Wenn jemand einen Bahnhof braucht, soll er sagen, wie er sich das vorstellt, was der Spaß kosten soll, liefert eine vernünftige Finanzierung und dann wird entschieden. Nicht umgekehrt. Und vor allem niemals mit Wasserwerfern und Pfeffersprays gegen unbescholtene Bürger und Kinder.
Das Problem, was ich nebenbei als Sozialdemokrat sehe, ist der Umstand, dass die Deppen am Ende vor allem, so wie man es gern in der Bevölkerung (und insgeheim auch gern mal in der SPD selbst) sieht, die Sozis sein werden. Schon heute ist weitgehend klar, dass keine Kostenkalkulation, die heute als offizielle Verlautbarung kursiert, jemals auch nur ansatzweise gehalten werden kann. Jede Kostensteigerung wird der Regierung angehängt werden und da vor allem denjenigen, die das Projekt einst befürworteten. Die nächste Landtagswahl wird, so weit kann man das schon skizzieren, für die SPD ein weiterer Niederschlag werden, auch da werden wieder genügend SPD-Verantwortliche mit weinerlicher Stimme jammern, wie schlimm es doch in Baden-Württemberg für die „Roten“ ist.
Nein, Genossen, so einfach ist selbst das jämmerliche Verlieren nicht mehr. Den Letzten beißen immer die Hunde. Dieses Jahr waren wir nicht die Allerletzten und nur das war der Grund, warum wir nicht auf der Oppositionsbank gelandet sind. Beim nächsten Mal aber, da haben wir quasi das Vortrittsrecht für die rote Laterne, weil wir eben heute sehr deutlich ahnen und immer noch nicht richtig darauf reagieren, dass das größte Kreuz dieser Legislaturperiode tatsächlich Stuttgart 21 ist und das dieser Bahnhof nicht einfach so getragen werden kann, wie man das jahrzehntelang vorher gemacht beziehungsweise geglaubt hat, dass sich das Kind schon von allein schaukeln wird.
Das wird es nicht. Und es wird schlimm. Und am Ende werden die, die es verbrockt und damit die letzte Landtagswahl verloren haben, sich als die „Manager in der Not“ aufspielen und nur damit die Wahl haushoch gewinnen. Wir werden es sehen.