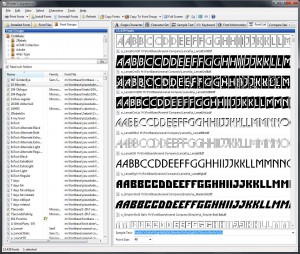Von Günther Oettinger kann man halten, was man möchte – Abstand ist vermutlich das allerbeste. Das galt schon hier in Baden-Württemberg, als er – so im Schnelldurchlauf erzählt – bei Drei nicht auf dem Baum war und Ministerpräsident wurde und später aus Gründen völliger Parteiverzweiflung und Amtsverschliss von Kanzlerin Angela Merkel nach Europa in Richtung Brüssel halbwegs gesichtswahrend weggelobt wurde. Danach lief es für die CDU in Baden-Württemberg zwar auch nicht besser, was aber wiederum symptomatisch eben für solche Politiker wie Oettinger ist. Eine Partei ist exakt so schlecht, wie ihr vermeintlich bester Politiker.
Nun ist Günther Oettinger aktuell EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Aus politischer Sicht eine Art Hilfsminister für ein Themenfeld, in dem die EU noch nie und auch nie auch nur ansatzweise eine Weltbedeutung einfahren wird und aus fachlicher Sicht mit Günther Oettinger fast so sinnvoll besetzt wie ich als fiktiver Bundesminister für Leistungssport. Günther Oettinger könne es sich extrem gut gehen lassen und es würde niemandem auffallen, wenn er sich anstatt im Dienstwagen von vier Zofen durch Europa tragen lassen würde, weil sein Amt so herzlich belanglos ist.
Nein, das passt nicht in das Amtsverständnis von Günther Oettinger. Günther Oettinger will immer etwas sagen. Das wird schon allein durch seine knurrige, näselnde, schnappende Aussprache und durch seinen Dialekt zum Kuriosum. Jede fachliche Äußerung steht aber immer auch unter dem schweren Los, dass er eigentlich noch weniger zu sagen hat, als es eigentlich zu sagen gibt. Oettinger ist nicht in der Lage, sich umfänglich zu informieren, zumindest aber völlig außerstande, etwas dahingehendes vortragen zu können. Ob es eine Faulheit zum Aktenlesen ist, weiß ich nicht, sicherlich kommt auch eine gewaltige Unlust dazu, sich in so ein Themenfeld hineinzuarbeiten, aber immerhin ist er EU-Kommissar. Man könnte es von ihm erwarten, sich sinnvoll auszudrücken und wenigstens keine Peinlichkeiten am laufenden Band zu verströmen.
Das Thema Netzneutralität scheint ihm wichtig zu sein bzw. vermutlich ist es eher so, dass er verinnerlicht hat, dass er zeigen muss, dass ihm das Thema wichtig sei. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass er zu diesem Thema seit Monaten täglich irgendwo etwas herunterreferiert und nicht eine dieser Äußerung eine mögliche Realität auch nur tangiert. Er versteht die Grundlagen der Vernetzung nicht, des Internets sowieso nicht und versucht dann auch noch, sein Vierteles-Wissen in Analogien zu verpacken, die allesamt fehlschlagen. Es gilt immer die Regel, dass nur Derjenige Analogien verwenden sollte, der auch die Grundlagen kennt, um diese dann vereinfachen zu können. Das kann für einen Günther Oettinger so natürlich nicht gelten.
Netzneutralität, also die Gleichbehandlung von Datenströmen im Internet (!) ist für Günther Oettinger nicht gut, weil es damit – seiner Meinung nach – nicht mehr gewährleistet sein kann, dass bestimmte Daten „pünktlich“ ankommen, wo auch immer. Autos könnten schlechter kommunizieren, wenn die Tochter auf der Rückbank zu viel in YouTube surft oder Operationen an Lunge oder Herz fehlschlagen, weil auf dem Dorf nicht genügend Internet durch die Leitung kommt. Äpfel, Birnen, Planeten, Taschenrechner und Fußnägel sind einfacher miteinander verglichen.
Glaubste nicht? Bitte anschnallen, eine Sternstunde der kleinen Gedankenwelt des Günther Oettinger:
Das, was Oettinger da herunterparliert und sich dabei entlarvend an belanglosen Details und empörten Beleidigungen aufhängt, ist selbstverständlich nicht viel mehr als klassisches Lobbyistengeblubber, höchstwahrscheinlich Wort für Wort auswendiggelernt von den einfachsten Papieren, die ihm da ins Büro hereingetragen werden. Lobbyarbeit ist immer geprägt davon, dass der Lobbyist die zu vermittelnde Information genau auf die fachliche Kapazität und Fähigkeit des Empfängers zuschneidet und dazu braucht es bei Günther Oettinger aus Sicht der Lobbyszene erfreulich wenig.
Dass es Leitungsvermittlung, Paketvermittlung, dass es bei der Übertragung absicherbare Servicelevels gibt und dass es für hochpriorisierte Anwendungen dedizierte Leitungen gibt – das will ein Günther Oettinger nicht lesen müssen und weil das so ist, schreibt das kein Lobbyist auf seinen Sprechzettel. Der Rest sind dann seine hanebüchenen Analogien aus der Kategorie „Bauernschlau“. Darüber nachzudenken, ist völlig verausgabte Zeit, man muss bei Oettinger streckenweise einfach weghören und wegschauen. Fremdschämen tut hier in Baden-Württemberg bei Günther Oettinger schon längst keiner mehr, denn man tut ihn sich nicht mehr an. Noch nicht mal als CDU-Parteigänger.
Tröstend also ist, dass auf Günther Oettinger schon längst keiner mehr hört und er auch nicht sonderlich ernstgenommen wird. In der CDU nicht, in Berlin nicht und in Brüssel vermutlich genauso wenig. Oettinger bekommt wirklich alles versemmelt, von der großen politischen Rede bis zur Grußrede in der Dorfkneipe, vom politischen Großprojekt bis zur städtischen Verordnung. Er ist ein prächtiger Vertreter des Typus Politicus, der irgendwie in den Betrieb hereingerutscht ist und zur temporären politischen Deponierung von A nach B herumgereicht wird, auf ewig. Einer, der das Nichtsetzen von Akzenten zum Karrieremotto auserkoren hat und sich bestens damit abfinden kann, wenn er irgendwo auf dem Land den Ehrenteller eines Dorfes vom Schultes überreicht bekommt.
Demzufolge kann Günther Oettinger nicht viel kaputtmachen, weil er nicht ansatzweise ein Entscheider ist, aber es sind leider genau solche Politiker, die Europapolitik verkommen und Europa für viele Menschen zum Hassobjekt generieren lassen. Wir werden Günther Oettinger aussitzen müssen.