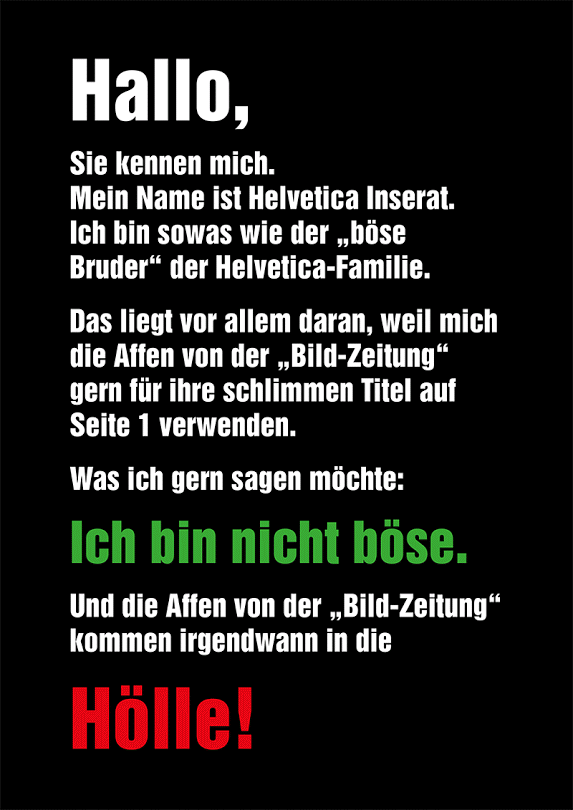Android ist ein schönes und übersichtliches Betriebssystem, nicht mehr nur für Smartphones, sondern auch für Tablets und viele andere Geräte. Wer aber die Nachrichten über Android in den letzten Wochen gelesen hat, kann sich durchaus die Frage stellen, ob es Google mit Android überhaupt ernst meint. Sicherheitsprobleme, die gleich Millionen von Geräten betreffen prallen auf die Versäumnisse, dass es immer noch kein einheitliches Konzept darüber gibt, wie man eigentlich bei bereits verkauften Geräten die Softwarepflege bewerkstelligen will. Während das bei eher kosmetischen Problemchen maximal ärgerlich ist, könnten echte Sicherheitsprobleme unter Umständen zukünftig vielleicht auch dazu führen, dass komplette Mobilfunknetze dann in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, wenn beispielsweise Android-Probleme zu fehlerhaft arbeitenden Smartphones führen.
Alles so Fragen, zu denen es fatalerweise immer noch keine Antworten gibt.
Smartphone-Hersteller sehen Smartphones zu singulär.
Wenn mir eines immer wieder auffällt, ist es die erschreckende Beobachtung, wie wenig Sorgfalt viele Smartphone-Hersteller auf die Software legen. Üblicherweise nehmen Hersteller die Android-Basis und setzen da dann ihren eigenen Aufsatz an Launcher und zusätzlichen Apps drauf. So weit, so schlecht. Denn hier prallen gleich mal westliche und fernöstliche Welt zusammen, denn während in Fernost ein Smartphone erst mit möglichst viel Klimbim (vulgo: Apps) begehrenswert erscheint, ist es in der westlichen Welt eher umgekehrt. Keep it simple.
Das haben viele Hersteller erkannt und liefern ihre Smartphones mit deutlich weniger vorinstallierten Apps aus, dafür jedoch mit einem eigenen App-Store. Google wiederum hat mit der Einführung von Android 4.0 Hersteller dazu verpflichtet, eigene Launcher nicht so zu implementieren, dass der Nutzer keine Auswahl mehr hat.
Die echten Ärgernisse kommen aber im Unterbau daher und hier wird von Seiten der Hersteller mitunter mächtig geschludert, in dem eigentlich vorhandene Android-Funktionen einfach deaktiviert werden. Beispiel: Das LG G3 meldet sich, so wie leider viele Android-Smartphones, akustisch, wenn der Akku voll ist. Das ist vielleicht ganz toll, wenn das Smartphone auf dem Tisch steht, aber störend, wenn das nachts passiert. Android bringt nun von Hause aus die Funktion mit, dass sich Benachrichtigungen nachts abschalten lassen, aber daran hält sich die Software des G3 nicht. Mit dem Ergebnis, dass es auch nachts piept, wenn der Akku voll geladen wurde.
Noch viel drastischer ist das, was zur Zeit zu einem ernsthaften Vertrauensverlust gegenüber Android führt, nämlich die mitunter erbärmliche Pflege der Software. Auch relativ neue Android-Smartphones erleben die meisten Updates im ersten Jahr, danach wird es dramatisch schlecht. Das LG G3 hat sein letztes Update beispielsweise Anfang des Jahres 2015 erhalten und dabei ist es nun gerade einmal ein Jahr auf dem Markt. Und: Wir reden auch noch gar nicht von Android 5.1, sondern immer noch von Android 5.0, während Google im Herbst die Nachfolger-Version von 5.1 präsentieren wird.
Bei anderen Herstellern sieht es teilweise nur wenig besser aus. Immer hat man den Eindruck, dass Software-Updates quälend lange dauern und dann auch noch immer wieder die Veröffentlichung von Updates herumgeschoben wird. Es gibt in Sachen Android auch nicht im entferntesten das Gefühl, dass hier Google und Smartphone-Hersteller an einem wie auch immer gearteten Strang ziehen. Das schafft kein Vertrauen.
Google ist übrigens mit seinen Nexus-Geräten, die ja eine Art Referenzdesign darstellen sollen, keinen Deut besser. Auch das Nexus 6, das ich selbst einsetze, erfährt kaum Updates, obwohl Google nachweislich an der Android-Software ständig Änderungen und Verbesserungen durchführt. Dass das Nexus 6 darüber hinaus die Merkwürdigkeit mitbringt, dass es sehr gute Hardware an Bord hat, die Google aber nicht ansatzweise nutzt (z.B. eine LED-Signalisierung und ein per Fingertip einschaltbarer Bildschirm, beides nicht nutzbar), ist auch so eine Geschichte, die man wohl nur bei Google verstehen mag.
Lifecycles mit festen Ansagen.
Wenn etwas teures dauerhaft funktionieren soll, kommt man um die Ansage eines Lifecycles nicht herum, also die Festlegung, wie lange man ein Gerät mit Updates versorgen wird. Das ist bei Desktop-Betriebssystemen Normalität und ein Grundpfeiler, dass sich Betriebssysteme in kommerziellen Umfeldern überhaupt einsetzen lassen. Und genau das fehlt der Android-Welt komplett.
Wir brauchen also tatsächlich eine Regelung, dass Smartphone-Hersteller für ihre Geräte feste Angaben darüber machen müssen, wie lange sie die Gerätschaften zu pflegen gedenken. Das tun sie zwar auch heute schon, nur werden diese Informationen nur selten auch nach außen hin kommuniziert, was ein echtes Problem darstellt und im Prinzip auch verbraucherfeindlich ist.
Während jetzt ein nicht gebundener Hersteller kaum gezwungen werden kann, regelmäßig seine Gerätschaften zu pflegen (außer mit gesetzlichen Regularien in einzelnen Ländern), könnte Google mit Android da sehr eindrücklich Zügel anlegen und Ansagen machen – wenn man denn wollte. Und es vielleicht gleich so machen, wie auch bei den Android-Smartwatches, wo sich Google von Anfang an die komplette Hoheit über die Software zusichern hat lassen. Mit dem Ergebnis, dass Android-Smartphones herstellerübergreifend alle zum gleichen Zeitpunkt Updates bekommen.
Keep it open (oder macht es zumindest irgendwann).
Auf meinen Android-Smartphones nutze ich schon seit Jahren die herstellereigene Android-Version nur kurz, um möglichst bald das Smartphone mit einer After-Sales-Androidversion zu installieren, in meinem Fall mit CyanogenMod. Das ist eine Truppe, die auf Basis der originalen Android-Quellen eine eigene Implementierung pflegt. Zu der Installation muss man zwar die meisten Smartphones „rooten“, also den Bootloader mehr oder weniger aufwendig knacken, aber mit Unsicherheit hat CyanogenMod nicht viel zu tun. Ganz im Gegenteil:
CyanogenMod bezieht die offiziellen Android-Updates in der Regel sofort, nachdem sie in den offiziellen Android-Quellen veröffentlicht werden. Und in vielen Fällen stellt die Programmiertruppe um CyanogenMod auch eigene Fixes bereit, um erkannte Sicherheitslöcher zu beheben. Das führt dazu, dass mit CyanogenMod bespielte Geräte oftmals erheblich aktueller sind, als alle anderen Smartphones mit Hersteller-Android – selbst bei den Nexus-Geräten. Ich bin so frei und behaupte, dass CyanogenMod das aktuellste Android ist, was man bekommen kann.
Bei einem PC würde es kaum jemand akzeptieren, wenn der Hersteller alles dafür tut, dass das Betriebssystem nicht gewechselt und auch nicht aktualisiert werden kann, wenn der Hersteller zu beidem keine Lust mehr hat. Bei einem Smartphone ist das leider überall immer noch gang und gäbe. Und genau hier wird sich auch für Hersteller irgendwann mal die Frage stellen, ob es nicht einfacher wäre, Geräte so einzurichten, dass ein interessierter Nutzer auch ohne große Biegungen eine andere, offene Android-Version einzuspielen. Das werden auch dann sicherlich nur ein Bruchteil der Besitzer tun, aber zumindest hätte man nach Ablauf der Gewährleistung und Garantie das Thema los, die Software der Gerätschaften selbst noch pflegen zu müssen, wenn man freundlich darauf verweisen kann, dass es After-Sales-Androidversionen wie CyanogenMod gibt.
Quo vadis, Android?
Android kann man sicher machen, zweifellos. Früher oder später wird es dann auch immer mehr Smartphones geben, die dann auch sicher sind. Was aber mit einer fehlenden Versionsstrategie niemals funktionieren wird: Breitflächige Innovationen. Mit einer zu fragmentierten Basis an Android-Versionen ist der Umstand, dass es schon jetzt gewaltig viele Hardware-Konstellationen gibt, nicht mehr zu bändigen. Google versucht zwar immer noch aufopfernd mit einem Verschieben von Programmier-APIs in austauschbare Apps eine zumindest grob einsetzbare Gerätewelt herzustellen, aber zukünftige Innovationen werden sich mit immer komplexen Details beschäftigen.
Beispiel: NFC ist nicht einfach NFC. NFC gibt es am Smartphone, an der Smartwatch und dann gibt es eine Reihe von Anwendungen, die spezialisierte NFC-Protokolle nutzen. Wie will man das einheitlich von Android 4.1 bis 5.1 durchziehen? Gibt es aber kein einheitliches NFC, gibt es auch kein mobiles Payment, das auf NFC aufsetzt.
Es wird der Zeitpunkt kommen, wo Google einen Teil von Android nicht mehr den Herstellern überlassen darf, weil sie nicht nur technisch nicht in der Lage sind, damit umzugehen, sondern weil sie offenkundig auch keine Lust haben, Produktversprechen abzugeben und/oder einzuhalten. Dieser Zeitpunkt ist gekommen.