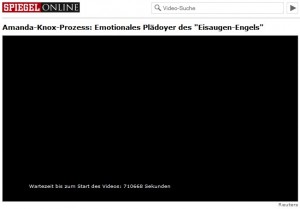So laut, wie die Obama-2012-Kampagne vor einigen Wochen angesprungen war, so auffällig leise ist sie wieder geworden. Man hört, selbst wenn man ein angemeldeter Campagnero ist, derzeit schlicht nichts. Kein Mailing, auf dem Kampagnen-Weblog ein eher leises Artikelgrundrauschen mit Zitaten aus dem Twitter-Stream und der Vorstellung von neuen Mitgliedern der Kampagnenführung. Kurzum: Belanglos. Man könnte glauben, dass da der Dampf heraus sei.
Diese Zeit ist natürlich nur augenscheinlich ruhig, denn im Hintergrund wird die Planungsmaschinerie wohl genau zu diesem Zeitpunkt so kräftig laufen, wie während der gesamten restlichen Kampagne nicht. Und dabei wird es weniger um das Thema Online gehen, sondern um die „echten“ Wahlkampfstrukturen.
Der Vorteil des Amtsbonus.
Selbst wenn man ein völlig unbegabter Politiker wäre und gar nichts zustande bringen würde (was man Barack Obama sicherlich nicht vorhalten kann), dann bleibt vor der nächsten Wahl immer noch der Amtsbonus, mit dem sich pfründen lässt. Der Amtsbonus ermöglicht es einem amtierenden Politiker, sich in der politischen Arbeit in Szene zu setzen und subtilen Wahlkampf zu betreiben, ohne dass es tatsächlich etwas kostet. Und wenn sich der Politiker geschickt dabei anstellt, können selbst die größten Kritik diese Aktivitäten zwar als billige Wahlkampfrhetorik abstempeln, diese Einschläge kann der Politiker jedoch ganz locker an sich abprallen lassen.
Es stellt sich bei einem amtierenden Politiker also nicht die Frage, ob er zu seiner Wiederwahl einen Amtsbonus hat oder nicht, sondern eher, wie hoch dieser Amtsbonus ist und was er daraus macht.
Wer steigt zuerst in den Ring?
In wirklich jedem Wahlkampf ist die Frage, wer zuerst in den Ring steigt, die Frage aller Fragen. Für gewöhnlich gilt das „silent agreement“, dass die Herausforderer möglichst früh ihre Ambitionen erklären (und damit in die Vorphase des Wahlkampfes einsteigen) und der Amtsinhaber – da er ja den Amtsbonus trägt – möglichst lange wartet und die Ankündigung seiner Kandidatur möglichst lässig in einem Nebensatz einer Rede fallen lässt.
Soweit zur Theorie, denn natürlich ist das alles auch eine Frage darüber, wer als erster das Heft in die Hand nimmt und danach auch in der Hand behält. Im Falle von Obama 2012 war tatsächlich Obama derjenige, der als erster erklärt hat, dass er wieder in den Ring steigen wird. Das ist zwar so absehbar wie der Umstand, dass auch morgen wieder die Sonne aufgehen wird, aber es ist vor allem ein deutliches Statement gewesen, dass gegen die Konkurrenz ging.
Die Republikaner haben nämlich bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2012 den Vor-/Nachteil, dass sie ihren Kandidaten erst einmal küren müssen. Während wir Europäer es eigentlich gewohnt sind, dass bei solchen internen Vorwahlkämpfen zumindest halbwegs kundige Menschen kandidieren, ist das in den USA eher so eine Art von „Mr.-und-Ms.-Universe-Wahlen“. Neben einigen Platzhirschen, die bereits in der US-Politik mehr oder weniger agieren, gesellen sich eine Reihe von Menschen dazu, die teilweise krude Weltbilder an den Tag legen, außer Showeinlagen nicht viel mehr beherrschen und eher an zweitklassische Schauspieler erinnern. Und darüber hinaus auch noch so hochalberne Geschichten, dass eine nationale Agrarmesse im Bundesstaat Iowa der Ort einer viel beachteten Vor-Vor-Vorwahl ist, in deren Rahmen ein nicht wirklich objektives Stimmungsbild schon für die ersten Verlierer in der Kandidatenriege sorgt. Und dann gibt es noch so querlaufende Politiker vom Kaliber Sarah Palin, die so beschränkt sind in ihren mentalen Fähigkeiten, dass es einem politischen Menschen fröstelnd die Fußnägel aufrollt.
Unsicherheit, Albernheit, fehlende Vertrauenswürdigkeit. Das sind die (selbstverständlich niemals direkt ausgesprochenen) Schlagworte, die den Amtsinhaber bei so einem Spektakel dann dazu bringen, als erster öffentlich zu vermitteln: „Schaut her, ich bin euer Präsident, ich mache den Job nochmal, als bin ich die Messlatte für den ganzen Kindergarten da.“
Messen am „Chef“.
Und auch wenn Barack Obama den obigen Satz niemals so aussprechen würde – so steht er im Raum. Und zwar in jedem, in dem ein Mensch, der auf die Idee kommt, zur US-Präsidentschaftswahl 2012 zu kandidieren, steht und irgnedeine Rede hält. Das sorgt neben den üblichen Ausschlusskriterien wie abgeschmolzenem Wahlkampfetat, fehlender Sympathie und Mangel an politischem Profil (in genau dieser Reihenfolge) für einen zusätzlichen Druck im gegnerischen Lager.
Mit der frühestmöglichen Bekundung auf Kandidatur bei der nächsten Präsidentschaftswahl spielt Obama den Amtsbonus demnach schon ganz am Anfang aus. Ein durchaus nicht ganz ungefährliches Spiel, was aber dadurch kalkulierbar ist, dass ein absoluter Traumkandidat bei den Republikanern auch heute noch nicht in Sicht ist. Man muss in den internationalen Nachrichten schon ganz gehörig tief suchen, um überhaupt einige Kandidaten nachrichtentechnisch verfolgt zu bekommen.
Abwarten und Tee trinken.
Innen agieren, nach außen Ruhe ausstrahlen. Das dürfte derzeit das Motto von Obama 2012 sein. Es besteht überhaupt kein Grund, in sichtbare Wahlkampfrhetorik einzusteigen, weil es aktuell niemanden gibt, gegen den man sinnvoll Wahlkampf führen könnte, ohne wirklich grundlos Geld zu verblasen.
Es fällt daher mehr als deutlich auf, dass derzeit in der gesamten Obama-2012-Kommunikation aktuelle politische Entwicklungen großflächig ausgeklammert und umgangen werden. Beispielsweise die Occupy-Bewegung. Eigentlich stünden viele Ansätze dieser Occupy-Bewegung durchaus in der politischen Grundausrichtung der Demokraten und es wäre für die Wahlkampfstrategen und die Spindoctors vermutlich einer der einfachsten Handgriffe, hier den Turn der Bewegung in die Kampagne einzubauen. Aber man tut es nicht. Nichts. No actual politics. Zumindest keine wirklich handgreiflichen. Alles, was an „Wall Street Reforms“ zu lesen ist, sind Dinge, die Barack Obama machen würde, wenn er denn nächstes Jahr gewählt würde. Ich bemerke: Wäre das echte Wahlkampfrhetorik, würde er jetzt reagieren und nicht erst Thesen aufstellen, was er bei einer erfolgreichen Wiederwahl ändern würde, denn die würden, rein rechnerisch, erst ab Januar 2013 umgesetzt werden können, wenn die nächste Legislaturperiode beginnt.
Alle Teile meines Dossiers zu Obama 2012 unter dem Stichwort „Obama 2012“.