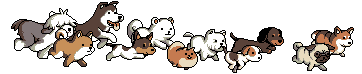Da die Artikel zum Thema Google Sync und iPhone in meinem Blog die mit Abstand am häufigsten aufgerufenen Artikel sind, hier doch nochmal ein wichtiger Hinweis für alle, die zukünftig ihr iPhone oder iPod per Google Sync mit ihren Kalendern und Adressbüchern in ihrem Google-Account synchronisieren möchten. Denn Google Sync steht auf der Abschussliste bei Google und für viele Nutzer ist Google Sync ab 30. Januar 2013 nur noch Geschichte.
Google Sync und der technische Hintergrund
Das Ende von Google Sync ist relativ einfach zu erklären, wenn man sich anschaut, was dahintersteckt: Eine Synchronisierungstechnologie namens ActiveSync von Microsoft. Und dazu ist dann ein kleiner Exkurs recht interessant:
ActiveSync hat eine recht lange Geschichte und hat seine Wurzeln im Mobilbetriebssystem Windows Mobile und der Möglichkeit zur Synchronisieren von Smartphone-Inhalten mit Windows-Betriebssystemen ab Windows 95 und NT 4. Für diese Anforderung wurde ActiveSync entwickelt und das war schon zu den Zeiten, als Windows Mobile mit dem einst allmächtigen Betriebssystem PalmOS von US Robotics konkurrierte, revolutionär. Denn während Palm-Geräte im am PC angeschlossenen Zustand nur dann synchronisierten, wenn die Synchronisierung am Gerät oder an der Dockingstation (die „Cradle“) die Synchronisierung explizit der Knopfdruck gestartet wurde, erledigten Windows-Mobile-Gerätschaften die initiale Autorisierung direkt nach dem Anstecken an den PC und synchronisierten während der Verbindung permanent, selbstständig und zuverlässig. Wurde in Outlook ein neuer Termin eingetragen, erschien dieser Termin im gleichen Moment auch im angeschlossenen Windows-Mobile-Gerät. ActiveSync machte es möglich und nicht zuletzt diese Technologie war ein wichtiges Abgrenzungskriterium zur Palm-Welt.
Aufgebohrt wurde ActiveSync dann später, in dem das Protokoll als Basis für die Synchronisierung zwischen Windows-Mobile-Geräten und dem Microsoft-Exchange-Server diente und fortan Exchange ActiveSync hieß. Das Prinzip der Echtzeitsynchronisierung blieb, lediglich der Übertragungsweg und die Gegenstation änderte sich. Nicht mehr der Bürorechner auf dem Schreibtisch war das andere Ende, sondern der Exchange-Server des Unternehmens, der dann die zu synchronisierten Inhalte direkt mit dem Postfach des Nutzers synchronisierte.
Und obwohl ja Microsoft verschrieen ist als ein Unternehmen, das rücksichtslos seine eigenen Standards entwickelt und verbreitet – ActiveSync hatte schon sehr früh eine relativ offene Lizenzierungspolitik und konnte von Herstellern von Personal Digital Assistants, später dann Smartphones, aber auch Herstellern von Mailsystemen und Betreibern von Maildiensten (kostenpflichtig) lizenziert werden. Das hatte natürlich einen Hintergrund, denn neben den Einnahmen durch die Lizenzierung war durch den Einsatz von ActiveSync potentiell das jeweilige Produkt auch fähig zum Kontakt mit Windows-Mobile-Gerätschaften oder auf der anderen Seite mit dem Exchange-Server.
Und da ergaben sich dann die seltsamsten Allianzen. Während z.B. RIM mit dem Blackberry und dem dazugehörigen Protokoll sowohl Endgeräte als auch Synchronisierungssoftware mit dem Mailsystem aus einer Hand liefert, können z.B. iPhone und Android-Geräte per ActiveSync mit dem Exchange-Server synchronisieren. Vorteil: Diese Synchronisierung kostet den Nutzer nichts, während bei Blackberry lange Zeit der Synchronisierungsdienst Geld kostete und zwar nicht zu knapp. Dass also ActiveSync so zuverlässig funktioniert und für Hersteller von Smartphones recht freizügig lizenziert werden kann, ist mit einer der Gründe, warum Microsoft lange Zeit die eigene Mobilbetriebssystemstrategie hat schleifen lassen und es hat ihnen zumindest im Business-Bereich nicht sonderlich viel finanziellen Schaden beschert. Das Lehrgeld in der Smartphone-Jungsteinzeit haben tatsächlich andere bezahlt.
Google und ActiveSync
Auch Google gehört zu den ActiveSync-Lizenznehmern und das wiederum aufgrund einiger Umstände:
- Google benötigt ActiveSync im hauseigenen Mobilbetriebssystem Android, um Android-Handys mit der Exchange-Welt synchronisieren lassen zu können.
- Google muss seine eigenen Kalender- und Kontaktedienste mit Schnittstellen zu ActiveSync ausstatten, um Smartphones mit anderen Betriebssystemen als Android eine Synchronisierung zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere für das iPhone, denn obwohl das iPhone direkt (ohne ActiveSync) mit Google Mail synchronisieren kann, wird ActiveSync wiederum zum Synchronisieren von Kalender und Kontakten benötigt, da das iPhone hier keine eigenen Schnittstellen zu den Google-Diensten hat (warum auch immer).
Punkt 2 muss man sich ob des Irrsinns auf der Zunge zergehen lassen – weil Apple und Google zu doof sind, iOS und Google-Dienste vollständig miteinander synchronisieren lassen zu können, muss ausgerechnet ein lizenzpflichtiges Microsoft-Protokoll den Lückenfüller machen.
Und weil genau das Kostenthema der ActiveSync-Lizenzierung für die (kostenlos nutzbaren) Google-Dienste eine Rolle spielen dürfte, ist ActiveSync nun wohl bei der Synchronisierung der Google-Accounts auf der Abschussliste. Immerhin gibt es aber einige begrenzende Ausnahmen für das Ende:
- Wird ein Google-Account bis zum 30. Januar 2013 noch mit ActiveSync synchronisiert, bleibt diese Möglichkeit für diesen Account auch darüber hinaus noch erhalten. Das Ende gilt also ab 30. Januar 2013 nur für bis dato noch nicht per ActiveSync synchronisierende Google-Accounts. Inwiefern es bis zu diesem Datum tatsächlich aktiv genutzt werden muss oder ob die Nutzung irgendwann in der Vergangenheit schon ausreicht, wird sich zeigen.
- Ebenfalls nicht betroffen von dem Ende sind Google-Accounts, die innerhalb der inzwischen auch kostenpflichtigen Google Apps angelegt sind. Google-Apps-Accounts werden also auch weiterhin per ActiveSync synchronisieren können und wer da noch das Glück hatte, in der vergangenen Kostenlos-Zeit einen Google-Apps-Account einzurichten, lebt immer noch komplett kostenlos.
Die kostenlosen Protokollalternativen zum Synchronisieren
Google beendet das Synchronisieren mit ActiveSync vor allem auch deshalb, weil es inzwischen kostenlose Protokolle zum Synchronisieren gibt, die auch hinreichend zuverlässig sind. Für das Synchronisieren von Kalender ist dies das CalDAV-Protokoll und für das Synchronisieren von Kontakten das CardDAV-Protokoll. Beide Protokolle sind (inzwischen offizielle) IETF-Standards und im Falle von CardDAV eine beschwerliche Geburt hinter sich.
Das ist auch einigermaßen nachvollziehbar, denn ein einheitlicher, herstellerübergreifender Standard liegt zunächst einmal nicht im Interesse der Hersteller von eigenen, proprietären Protokollen und da lange Zeit die Motivation an echten freien Protokollen fehlte, dauerte es auch dementsprechend, bis beide Protokolle jeweils die Hürden genommen hatten, um als IETF-Standard zu gelten – zumal alle involvierten Hersteller innerhalb der IETF auch an der Standardisierung beteiligt waren. Das Wort „Sabotage“ will niemand in den Mund nehmen, aber IETF-Standardisierung ist mitunter auch interessant für Beobachter, die sich für Rudelbildungen im Tierreich interessieren.
Was zu tun ist … Empfehlungen
Also, grundsätzlich: ActiveSync muss niemand unbedingt einsetzen, der auch CalDAV und CardDAV einsetzen kann. Beide Protokolle sind gleichwertig funktional, wenn es um die Synchronisierung von Kalender- und Kontaktdatenbanken geht. Selbstverständlich ist ActiveSync deutlich mächtiger, allerdings richten sich viele Funktionen von ActiveSync vornehmlich an Unternehmen, die z.B. in einer Exchange-Infrastruktur alle Arten von Clients – vom Windows-Rechner mit Outlook bis zum iPhone – synchronisieren und zentral verwalten müssen.
Innerhalb von Google-Diensten ist ActiveSync bzw. der eigene Name „Google Sync“ immer als bisher mehr oder weniger notwendige Alternative zu verstehen. Es besteht also kein Grund zur Panik und auch nicht zu übermäßiger Hektik in Sachen Synchronisierungen zum Google-Konto einrichten. Wer bis zum 30. Januar 2013 Google Sync bzw. ActiveSync nicht einsetzt, wird es auch danach nicht vermissen, den selbst das iPhone, die Ausgeburt an Apple-Scheuklappentum in Sachen offenen Standards, unterstützt CalDAV und CardDAV
Zu erledigende Aufgaben für Besim
Das inzwischen gewachsene Sammelsurium an Blog-Artikeln, die sich mit der Synchronisierung zwischen Google-Konto und iPhone beschäftigen, aktualisieren. Die Artikel, die Google Sync erklären, werden mit Hinweisen darauf versehen, dass Google Sync nicht mehr bei allen Arten Google-Accounts funktioniert, der Artikel zu CalDAV so überarbeitet, dass es wieder als Empfehlung gilt und ein Artikel zu CardDAV neu geschrieben, das ich bisher großflächig ausklammerte, weil die CardDAV-Unterstützung von Google vor zwei Jahren, als ich das erste und bis dato letzte Mal in dieser Konstellation mit CardDAV experimentierte, schlicht unmöglich war.
Manchmal hilft die wohltuende Wirkung der Zeit doch, dass Hersteller sich ihren Möglichkeiten zur Interoperabilität bewusst werden.